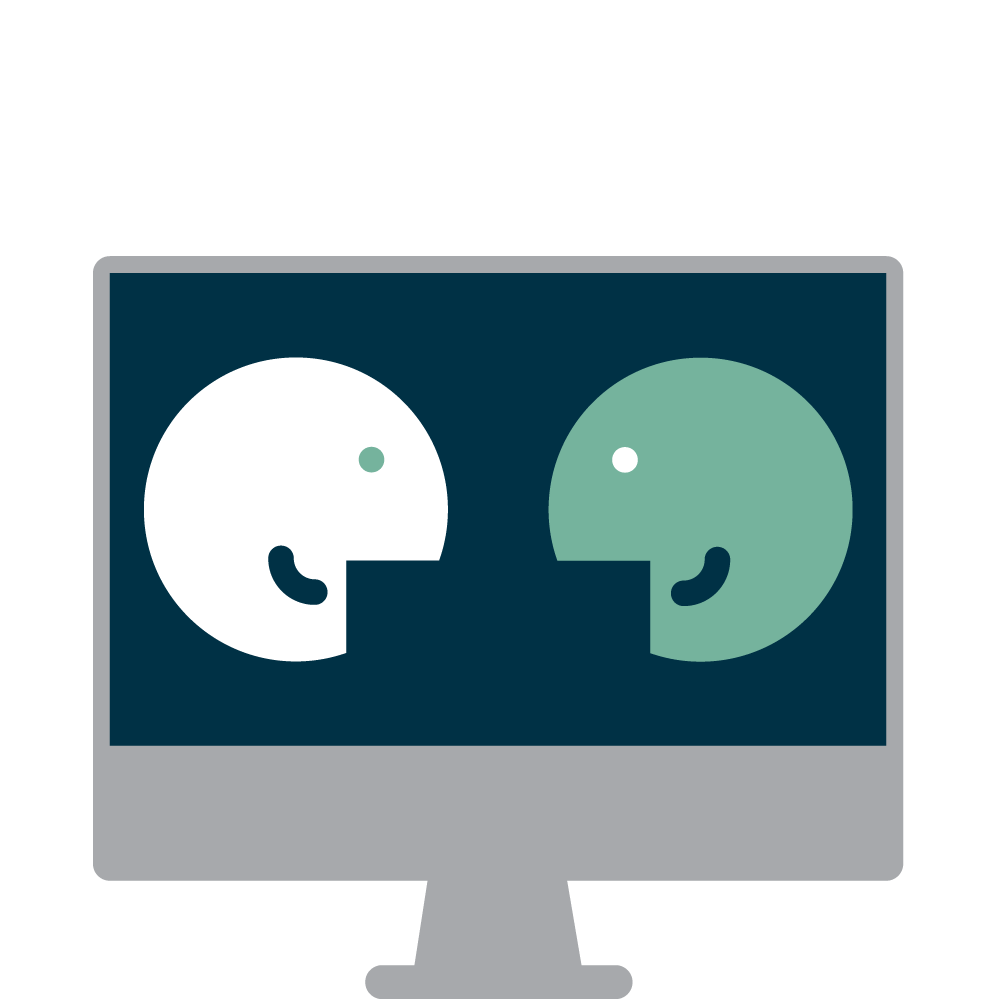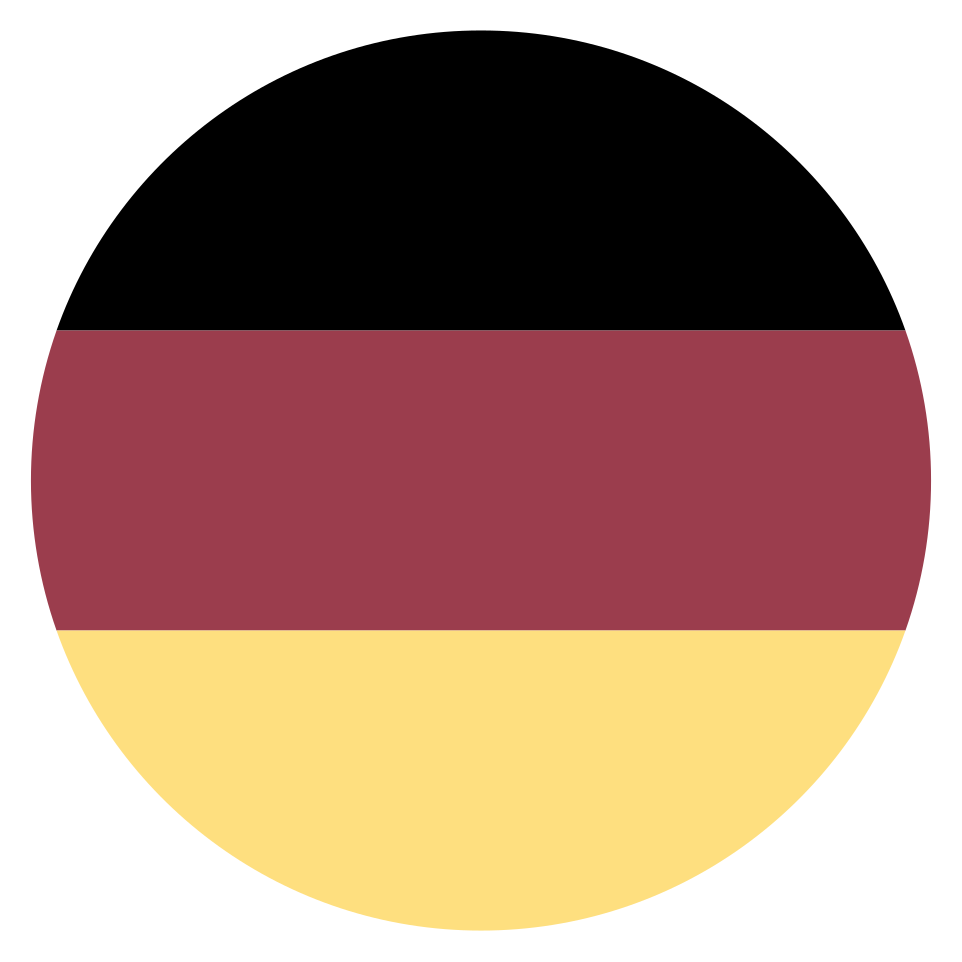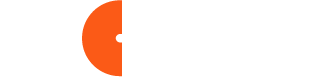Green Deal vs. Green Claims: Orientierung im EU‑Regelwerk gegen Greenwashing
Veröffentlicht am 11th November 2025
Häufig im Zusammenhang mit Politik und Klimaschutz genannt, ist doch nicht immer klar, was sich eigentlich hinter den Begriffen „Green Deal“ und „Green Claims“ verbirgt.

Was ist der Unterschied zwischen „Green Deal“ und „Green Claims“?
Kurz gesagt: Der europäische Green Deal ist die große, politische Gesamtstrategie der Europäischen Union für Klimaschutz und Nachhaltigkeit; Green Claims meint dagegen Umweltaussagen von Unternehmen und betitelt einen konkreten Vorschlag für eine europäische Richtlinie. Diese und die bereits beschlossene EmpCo-Richtlinie sollen Greenwashing, insbesondere auch durch das Verbot nicht nachweisbarer „Green Claims“, bekämpfen.
Der europäische Green Deal soll Emissionen unter anderem durch Förderung nachhaltiger Investitionen und Innovationen sowie die Stärkung der Kreislaufwirtschaft senken. Außerdem versucht die Europäische Union, Verbraucherinnen und Verbraucher zu ermächtigen, nachhaltige Produkte zu erkennen und eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Dies fällt zunehmend schwer, da häufig Produkte mit grünen Versprechen beworben werden, ohne dass nachvollziehbar ist, was eigentlich dahintersteckt. Unternehmen sollen daher bestimmte Regeln in der Werbung beachten.
Was ist der europäische Green Deal?
Der „Green Deal“ ist eine von der Europäischen Kommission im Jahr 2019 ins Leben gerufene Strategie mit dem Ziel, Europa bis 2050 in mehreren Etappen als ersten Kontinent klimaneutral zu machen: Bis 2030 soll eine Verringerung der Emissionen um mindestens 55 % und bis 2040 um 90 % erzielt werden.
Der Green Deal nimmt Treibhausgas-Emissionen, den gesamten Umbau der Wirtschaft und des Alltagslebens in den Blick. Gefördert werden soll unter anderem die effizientere Nutzung von Ressourcen und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft, die Wiederherstellung der Biodiversität und die konsequente Bekämpfung von Umweltverschmutzung. Ebenfalls zentral sind Investitionen in Innovation, saubere Technologien und grüne Infrastruktur.
Welche Auswirkungen hat der Green Deal?
Praktisch funktioniert der Green Deal als Dachrahmen: Unter ihm laufen zahlreiche Einzelinitiativen, Programme und Rechtsakte – von strengeren Energieeffizienzstandards über neue Vorgaben für nachhaltige Produkte bis hin zu Maßnahmen für transparente Informationen. Beispiele für solche Rechtsakte sind die EmpCo-Richtlinie, die in erster Linie Greenwashing bekämpfen soll und die Ökodesign-Verordnung, die unter anderem für bestimmte Produkte ein Vernichtungsverbot vorsieht.
Was versteht man unter Green Claims?
„Green Claims“ sind umweltbezogene Werbeaussagen. Sie reichen von Begriffen wie „klimaneutral“ oder „CO2-kompensiert“ über „100 % recycelbar“ bis zu „ressourcenschonend hergestellt“. Solche Angaben können Verbraucherinnen und Verbrauchern die Kaufentscheidung erleichtern und Unternehmen belohnen, die in Nachhaltigkeit investieren. Hierfür müssen Umweltaussagen verständlich und im Zweifel nachprüfbar sein.
Viele Green Claims sind zu pauschal
Häufig sind sie dies jedoch nicht: Viele Umweltaussagen erschöpfen sich in pauschalen Behauptungen, die gut klingen, aber wenig erklären. Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Umweltaussagen hat in den vergangenen Jahren zu Recht gelitten. Einer Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020 zufolge waren 53,3 Prozent der geprüften Umweltaussagen vage, irreführend oder unfundiert. Letztlich setzt sich entgegen den Zielen des Green Deals das beste Marketing durch – nicht die beste Lösung für Klima und Umwelt.
EmpCo- und Green-Claims-Richtlinie sollen für mehr Transparenz sorgen
Um hier gegenzusteuern, hat die Europäische Kommission in Ergänzung zur bereits beschlossenen EmpCo-Richtlinie einen Vorschlag für eine Green-Claims-Richtlinie vorgelegt. Ziel beider Richtlinien ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zuverlässige, vergleichbare und überprüfbare Umweltinformationen zu bieten.
Wer mit der Umweltfreundlichkeit eines Produkts wirbt, soll dies auf solider Grundlage tun und darf diese in der Werbung nicht überhöhen. Außerdem sollen Umweltkennzeichnungen – also Siegel und Labels – nur noch zulässig sein, wenn sie staatlich festgesetzt sind oder auf einem belastbaren Zertifizierungssystem beruhen.
Nach dem aktuellen Entwurf der Green Claims-Richtlinie müssen Unternehmen außerdem darlegen, worauf eine Umweltaussage beruht, welche Methode sie zur Bewertung verwenden und welche Daten ihr zugrunde liegen. Eine unabhängige Stelle soll diese Angaben überprüfen, bevor sie in der Werbung kommuniziert werden.
Ob und wann die Green-Claims-Richtlinie in Kraft tritt, ist noch offen. Die Europäische Kommission hatte im Sommer zunächst überraschend erklärt, den Vorschlag zurückzuziehen, dann aber erkennen lassen, dass sie an ihm festhalte.
Green Deal für Unternehmen Herausforderung, aber auch Chance
Für Unternehmen stellen die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Green Deals eine Herausforderung, aber auch eine Chance dar. Gefragt sind reale Verbesserungen – weniger Emissionen, sparsamere Ressourcennutzung, bessere Reparierbarkeit und Kreislauffähigkeit – und eine Kommunikation, die diese Fortschritte überprüfbar darstellt.
Bereits jetzt sind vage Umweltaussagen regelmäßig wegen ihrer potenziellen Irreführung nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) unzulässig. Unternehmen, die mit solchen Umweltaussagen werben, rücken schon jetzt in den Fokus.
So hat im vergangenen Jahr der Bundesgerichtshof in einem Verfahren der Wettbewerbszentrale gegen den Süßwarenhersteller Katjes entschieden, dass dieser seine Produkte nicht mit „klimaneutral“ bewerben darf, ohne dabei klarzustellen, dass keine Reduktion, sondern eine bloße Kompensation von CO2 erfolgt.
Zudem hat die Deutsche Umwelthilfe im September bekannt gegeben, gegen mehr als 30 Unternehmen wegen Greenwashing und Verbrauchertäuschung vorzugehen.
Unternehmen sollten daher schon jetzt – auch mit Blick auf die bis 2026 umzusetzende EmpCo-Richtlinie – ihre Green Claims gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern kritisch überprüfen.