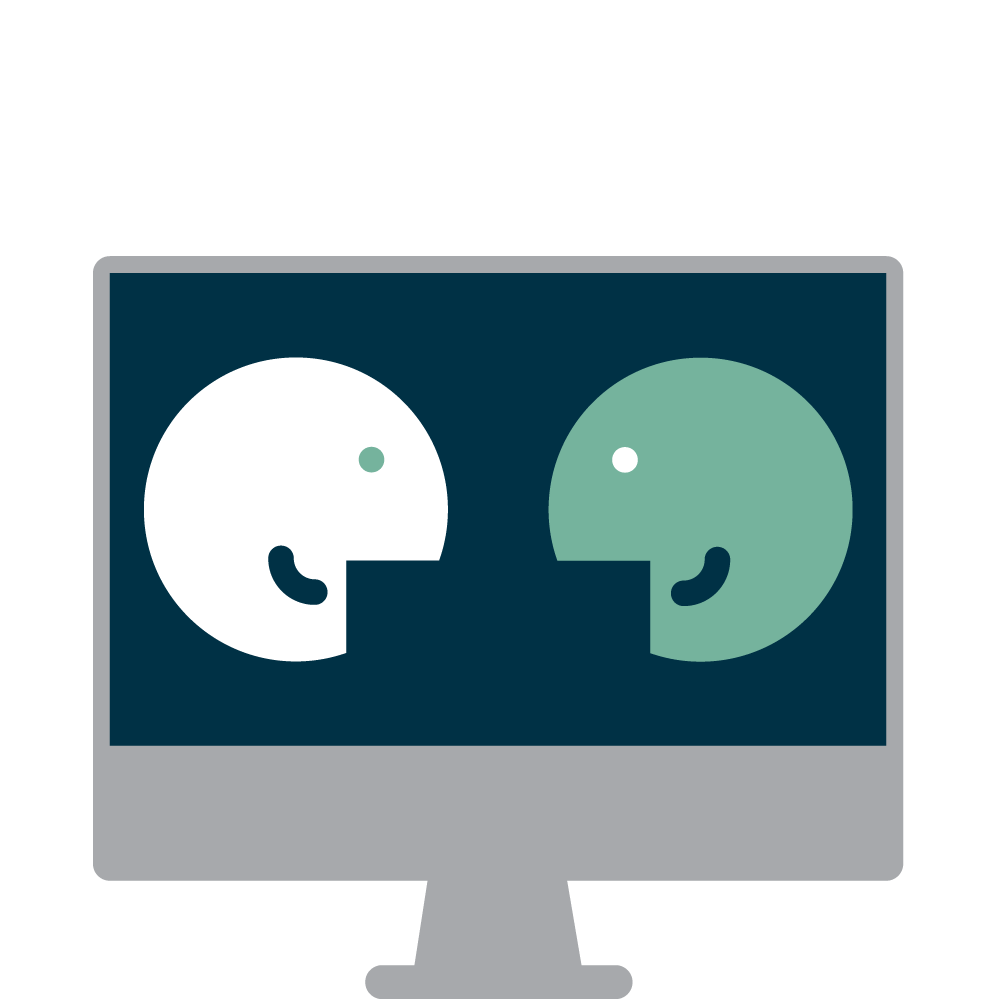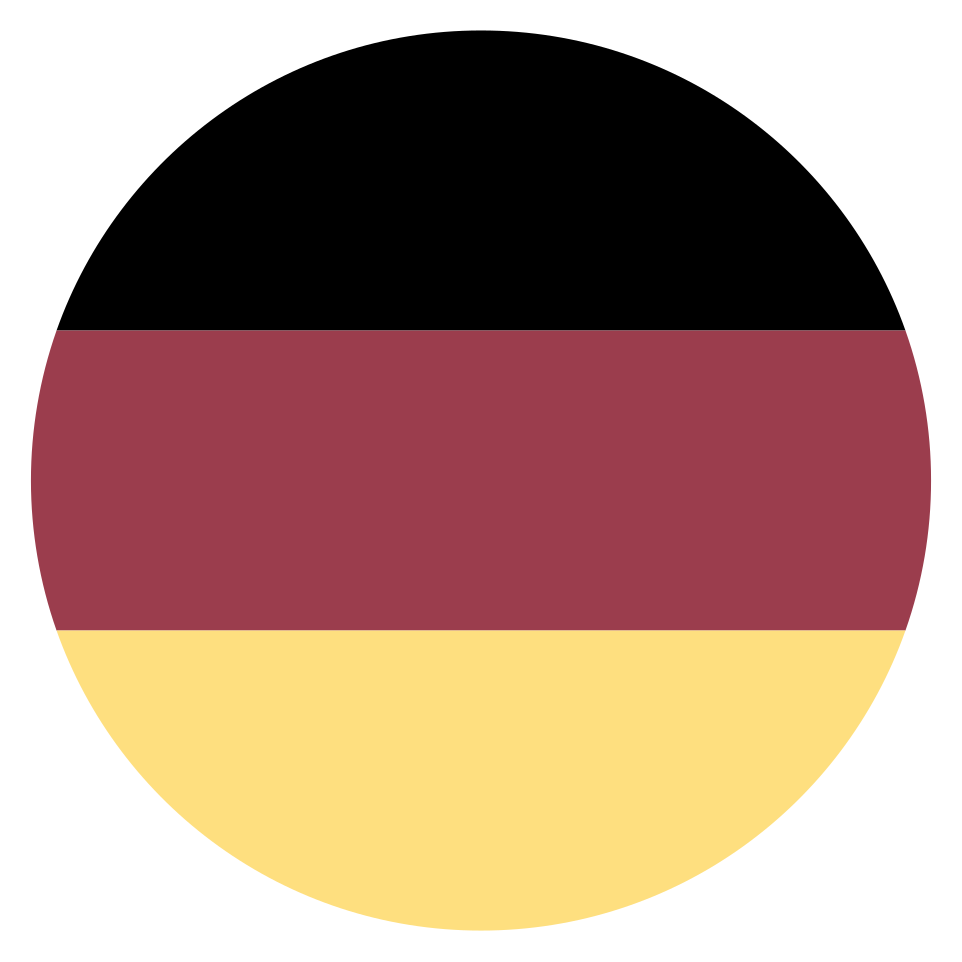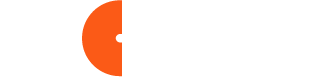Digital Fairness Act Unpacked: Digitale Verträge
Veröffentlicht am 16th Oktober 2025
Der einschlägige Rechtsrahmen ist vielschichtig, es liegen Leitlinien vor. Trotzdem ist die Umsetzung mit Herausforderungen verbunden.

Noch bis zum 24. Oktober 2025 läuft die öffentliche Konsultation zum Digital Fairness Act (DFA), in deren Rahmen Unternehmen, Verbände und andere Interessenträger ihre Perspektive in den Gesetzgebungsprozess einbringen können, was auch den Bereich „Digitale Verträge“ und den künftigen Umgang der Europäischen Kommission mit diesen umfasst.
Worum geht es, wenn die Kommission Digitale Verträge in den Blick nimmt?
Vom Vertragsschluss bis zur Verlängerung und zur Beendigung – Digitale Verträge können Verbraucherinnen und Verbrauchern vor einige Hürden stellen. Die Kommission adressiert insbesondere vier Aspekte entlang des gesamten Vertragszyklus:
- Vertragsautomatisierung: KI-gestützte oder (teil-)autonome Vertragsschlüsse über digitale Assistenten oder smarte Geräte.
- Automatische Verlängerungen und kostenlose Testphasen: Kostenlose Testphasen, die automatisch in ein kostenpflichtiges Angebot übergehen, und kostenpflichtige Abonnements, die sich automatisch und ohne Zutun der jeweiligen Kundinnen und Kunden verlängern.
- Fehlende persönliche Ansprechpartner: Kundensupport, bei dem keine menschlichen Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sondern nur automatisierte Chatbots.
- Beendigungsmöglichkeiten: Kündigungen, die nicht genauso einfach sind wie der Abschluss eines Vertrags; auch die Idee von Stornierungsschaltflächen wird untersucht.
Welchen Rechtsrahmen gibt es schon jetzt für Digitale Verträge und wird dieser durchgesetzt?
Europäischer Rechtsrahmen
Mehrere EU-Rechtsakte bilden ein Gerüst für den Verbraucherschutz bei Digitalen Verträgen:
Verbraucherrechte-Richtlinie (VRRL): Die VRRL regelt für Verträge im Fernabsatz bereits umfassende vor- und nachvertragliche Pflichten. Beispielsweise muss vor dem Vertragsschluss über die Laufzeit des Vertrags, Kündigungsbedingungen sowie einen Gesamtpreis einschließlich der Kosten pro Abrechnungszeitraum oder die monatlichen Kosten von Abonnements informiert werden (Art. 6(1)(e), (o), (p)). Regelungen trifft die VRRL auch im Hinblick auf die Beendigung von Verträgen und sie etabliert insbesondere das 14-tägige Widerrufsrecht (Art. 9 ff.). Mit der Neufassung der Verbraucherrechte-Richtlinie durch die Richtlinie (EU) 2023/2673 zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen verlangt die VRRL nun auch eine „Button-Lösung“ zur Ausübung des Widerrufsrechts (Art. 11a). Dieser Widerrufsbutton wird für alle online abgeschlossenen Fernabsatzverträge erforderlich sein, er ist nicht auf Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen beschränkt. Die Umsetzung dieser Neuerung in nationales Recht muss bis zum 19. Dezember 2025 erfolgen und das neue Recht ab dem 19. Juni 2026 gelten.
E-Commerce-Richtlinie: Die E-Commerce-Richtlinie regelt ebenfalls zentrale Aspekte elektronisch geschlossener Verträge. Insbesondere legt sie Unternehmen weitere Informationspflichten auf, die zur Vertragstransparenz und -klarheit beitragen sollen. So müssen Verbraucherinnen und Verbraucher beispielsweise vor Abgabe einer Bestellung klar und verständlich über die einzelnen Schritte des Vertragsschlusses informiert werden (insb. Art. 5, 6 und 10).
Digitale-Inhalte-Richtlinie: Die Richtlinie schafft die rechtliche Grundlage für die Qualität und sichere Bereitstellung digitaler Inhalte und Dienstleistungen und damit eine Basis für die Funktionsfähigkeit des Gegenstands digitaler Verträge. Sie regelt beispielsweise Verbraucherrechte bei Mängeln und damit zwar nicht direkt die Gestaltung und Verwaltung Digitaler Verträge, schafft aber Regelungen für zuverlässige digitale Leistungen, die Voraussetzung solcher Vertragsverhältnisse sind.
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-Richtlinie): Die UGP-Richtlinie klassifiziert irreführende und aggressive Geschäftspraktiken als unlauter und damit verboten, sofern sie das Verbraucherverhalten in Bezug auf geschäftliche Entscheidungen negativ beeinflussen. Es kann irreführend und daher unlauter sein (insb. gem. Art. 6 und 7), wenn Unternehmen gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht deutlich machen, dass sie bei der Buchung eines kostenlosen Probeabonnements ein Abonnement abschließen, oder sonstige Informationen über wiederkehrende Kosten eines Abonnements nicht bereitstellen. Wesentliche Informationen wie Preis, Rücktritts- und Widerrufsrechte müssen nämlich klar und verständlich vor Vertragsschluss angegeben werden (vgl. Art. 7(4)). Außerdem stellt die Kommission hier den Grundsatz heraus, dass Abmeldungen, d. h. Kündigungen oder sonstige Beendigungen, von einem Dienst genauso einfach sein sollen wie die Anmeldung zu diesem Dienst (siehe Bekanntmachung der Kommission zur Auslegung und Anwendung der UGP-Richtlinie, Abschnitt 4.2.7). Wird dieser Grundsatz nicht eingehalten, kann dies ein irreführendes Unterlassen oder eine aggressive Geschäftspraxis sein (Art. 7, 9).
Digital Services Act (DSA): Der DSA regelt zwar primär die Verantwortlichkeiten von Online-Plattformen und Vermittlungsdiensten, enthält jedoch ebenfalls an digitale Vertragspraktiken anknüpfende Bestimmungen: Insbesondere ist es Online-Plattformen untersagt, ihre Online-Schnittstellen so zu gestalten, dass Nutzer:innen in ihrer Fähigkeit, freie und informierte Entscheidungen zu treffen, maßgeblich beeinträchtigt oder behindert werden (Art. 25). In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich auch der Fall benannt, dass das Verfahren zur Beendigung eines Dienstes schwieriger ist als die Anmeldung (Art. 25(c)).
KI-Verordnung: Art. 5(1)(a) und (b) der KI-Verordnung verbieten unterschwellige manipulative, täuschende oder die Schwachstellen bestimmter Personen ausnutzende Techniken, wenn diese (wahrscheinlich) zu erheblichen Schäden führen. Die KI-Verordnung macht daher zwar selbst keine besonderen Vorgaben für KI-gestützte oder (teil-)autonome Vertragsschlüsse. Sie bildet aber eine rechtliche Grundlage und damit einen Mindeststandard auch für die Automatisierung von Verträgen sowie die Kommunikation mit digitalen, KI-gestützten Assistenten im Kundensupport.
EU-Mitgliedstaaten mit Vorsprung
Nicht nur auf EU-Ebene werden die von der Kommission aufgegriffenen Aspekte adressiert. Teilweise sind die Mitgliedstaaten hier bereits einen Schritt weiter:
So verpflichtet in Deutschland § 312k BGB Unternehmen bei elektronisch abgeschlossenen Dauerschuldverhältnissen, also insbesondere Abonnements, einen Kündigungsbutton bereitzustellen. Dieser muss leicht zugänglich, gut lesbar und eindeutig beschriftet sein. Dies soll dem auch auf europäischer Ebene aufgestellten Credo folgen: Jede Kündigung soll genauso einfach sein wie der Vertragsschluss (siehe Deutscher Bundestag, Drucksache 19/30840, S. 15).
In Frankreich besteht eine vergleichbare Pflicht: Unternehmen müssen Verbraucherinnen und Verbrauchern die Kündigung über eine entsprechende Schaltfläche ermöglichen (Artikel L215-1-1 Code de la Consommation und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen). Zusätzlich verpflichtet das französische Recht zur Information vor jeder automatischen Vertragsverlängerung (Artikel L215-1 Code de la Consommation).
Durchsetzung
Der Einsatz von KI-Tools und automatisierten Techniken beim Vertragsschluss sowie in der weiteren Vertragsverwaltung ist derzeit zwar nicht ausdrücklich im bestehenden regulatorischen Rahmen benannt. Ein rechtlicher Rahmen besteht aber dennoch, gerade in Bezug auf Informations- und Transparenzpflichten. Andere Aspekte der digitalen Vertragsverwaltung werden teils expliziter geregelt – insbesondere Vertragsschlüsse, -umwandlungen und -verlängerungen sowie deren Beendigung. Werden dabei intransparente Geschäftspraktiken eingesetzt, sind zudem die von der Kommission in der Konsultation unter dem Stichwort „Dark Patterns“ diskutierten Erwägungen einschlägig.
Die Durchsetzung der bestehenden Regelungen konzentriert sich bislang vor allem auf diese ausdrücklich adressierten Aspekte Digitaler Verträge: Im Rahmen koordinierter Sweeps des Consumer Protection Cooperation Network (CPC‑Netzwerks) wurden bereits unterschiedlichste digitale Vertragspraktiken überprüft. Beispielsweise hat Amazon nach Gesprächen mit dem CPC-Netzwerk den zuvor komplexen Kündigungsprozess überarbeitet. Automatisierte und KI-gestützte Praktiken werden zukünftig unter Umständen ebenfalls stärker vom CPC-Netzwerk ins Visier genommen.
Welche Maßnahmen stellt die Kommission zur Diskussion und wie sind diese einzuordnen?
Die Kommission prüft derzeit, ob und wie im Bereich der Digitalen Verträge vorgegangen werden soll, z. B. mit regulatorischen oder nicht-regulatorischen Maßnahmen, wobei insbesondere folgende Maßnahmen konkret in Betracht gezogen werden:
- Vertragsautomatisierung: Die Kommission fragt, ob „spezifische Maßnahmen“ zum Verbraucherschutz ergriffen werden müssen. Solche schlägt die Kommission selbst aber nicht vor.
- Automatische Verlängerungen und kostenlose Testphasen: Die Kommission fragt hier, ob Verbraucherinnen und Verbraucher von „mehr Transparenz“ profitieren sollen. Dies könnte beispielsweise durch eine Erinnerung vor einer automatischen Verlängerung oder vor dem Übergang einer kostenlosen Testphase in ein kostenpflichtiges Abonnement erfolgen. Auch wird zur Diskussion gestellt, ob Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Kontrolle über ihre Verträge haben sollen, insbesondere durch kurze Kündigungsfristen von automatisch verlängerten Abonnements oder indem sie der automatischen Verlängerung oder Umwandlung ihres Abonnements ausdrücklich zustimmen müssen.
- Fehlende persönliche Ansprechpartner: Es wird erwogen, ob Verbraucherinnen und Verbraucher das Recht auf persönliche Ansprechpartner haben sollen.
- Beendigungsmöglichkeiten: Im Bereich der Vertragsbeendigungen wird die Einführung von einfachen Funktionen zur Vertragsbeendigung auf der Schnittstelle des Unternehmens diskutiert, beispielsweise durch Links oder Schaltflächen.
Einordnung
Der skizzierte regulatorische Rahmen zeigt: Die Aspekte, die bei Digitalen Verträgen zu berücksichtigen sind, sind vielfältig. Zugleich sind zentrale Leitplanken bereits gesetzt. So enthalten etwa die VRRL und die UGP-Richtlinie umfassende Vorgaben, die durch Leitlinien bereits weiter konkretisiert wurden. Dennoch liegen die größeren Herausforderungen weiterhin im „Wie“ der Umsetzung. Eine präzisere Guidance hinsichtlich der Anwendung und Durchsetzung dieser bestehenden Vorschriften sollte daher vor der Ergänzung um weitere regulatorische Anforderungen evaluiert werden. Der Einsatz von KI-gestützten Technologien und automatisierten Prozessen ist in der bisherigen Guidance hingegen kaum unmittelbar adressiert. Auch in dieser Hinsicht lohnt es sich zu prüfen, ob der bestehende Rechtsrahmen effektiver oder effizienter für KI-gestützte Technologien genutzt werden kann, auch durch klare Leitlinien zur Implementierung und Durchsetzung.
Dieser Insight ist der Neueste in unserer Miniserie zu den Themen der Konsultation, in der wir bisher Dark Patterns, Addictive Designs, spezifische Funktionen in digitalen Produkten, Unfaire Personalisierungspraktiken, Unfaire Praktiken von Social Media Influencern und Unfaire Preisgestaltung untersucht haben.