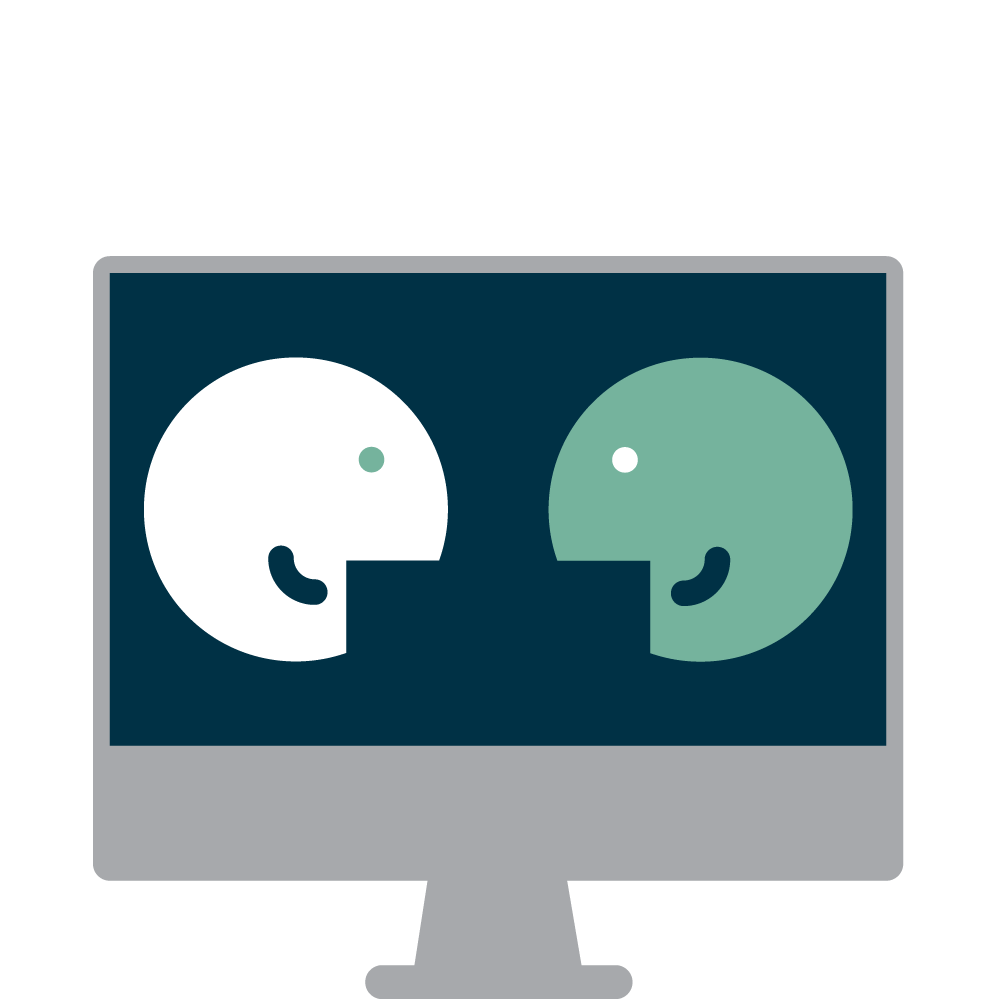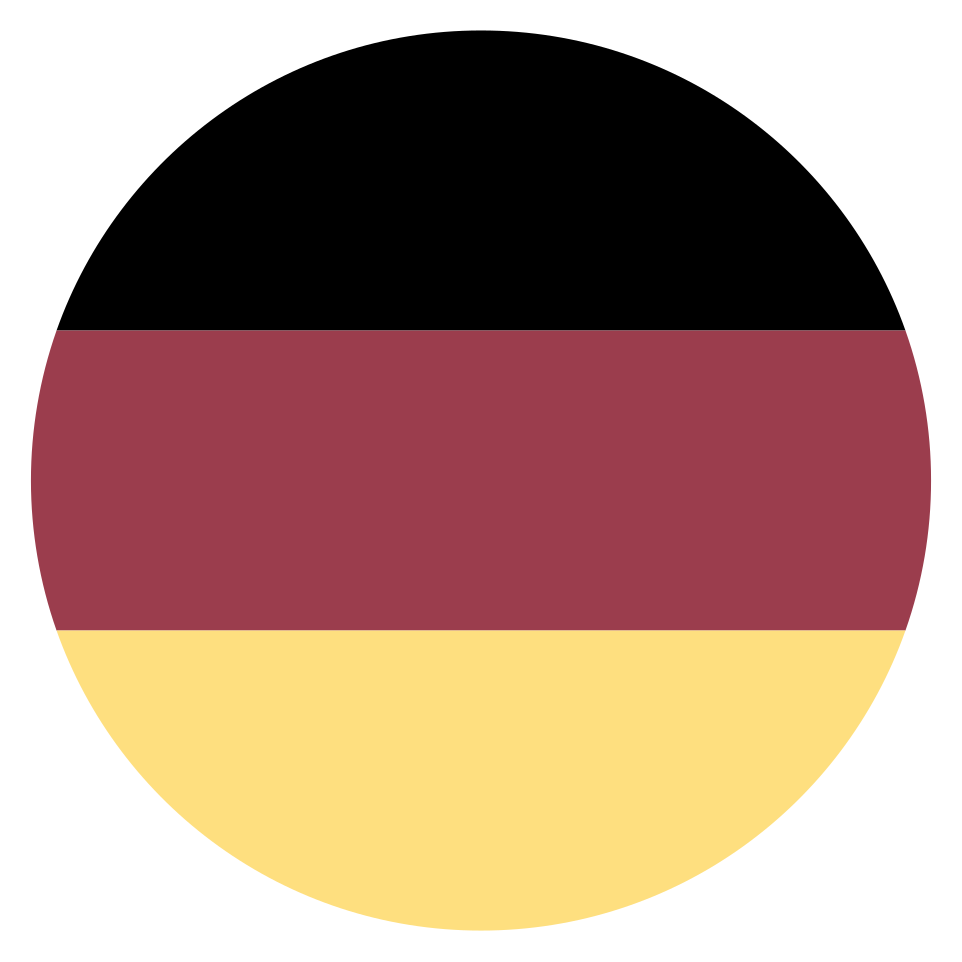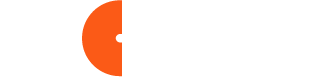Digital Fairness Act Unpacked: Funktionen in digitalen Produkten – insbesondere solche, die häufig in Videospielen vorkommen.
Veröffentlicht am 12th August 2025
Am 17. Juli 2025 hat die Europäische Kommission die öffentliche Konsultation zum Digital Fairness Act (DFA) eröffnet und Unternehmen, Verbänden sowie anderen Interessenträgern die Möglichkeit gegeben, ihre Standpunkte in den Gesetzgebungsprozess einzubringen.
Unsere Miniserie befasst sich mit den Themen, die in der Konsultation angesprochen werden. Im dritten Teil unserer Serie betrachten wir genauer, welche Bedenken die Europäische Kommission zu bestimmten Funktionen in digitalen Produkten – insbesondere solchen, die häufig in Videospielen vorkommen – äußert und wie die derzeitige regulatorische Landschaft dafür aussieht.

Was sind laut Konsultation die „Funktionen digitaler Produkte“?
Die Europäische Kommission richtet den Blick auf bestimmte als problematisch angesehene Funktionen in digitalen Produkten, insbesondere solche, die häufig in Videospielen vorkommen. In der Konsultation werden dabei unter anderem folgende Beispiele genannt:
- Nutzung von In-Game-Währung – virtuelle Objekte, die in vielen Spielen verwendet werden und die man durch echtes Geld erwerben (und/oder erspielen) und sie dann im Spiel gegen andere In-Game-Gegenstände eintauschen kann;
- Zufallsbasierte Rewards (z. B. „Lootboxen“) – die Verbraucher:innen entweder durch echtes Geld oder In-Game-Währung erhalten, um eine Chance auf zufallsgenerierte Gegenstände oder Vorteile zu erhalten; und
- Pay-to-Progress- und Pay-to-Win-Mechanismen – bei denen man für echtes Geld oder mithilfe von In-Game-Währung im Spiel Vorteile erhalten kann.
Nach Ansicht der Europäischen Kommission könnten diese Merkmale Probleme beim Verbraucherschutz aufwerfen, da sie möglicherweise zu übermäßigen Ausgaben verleiten, insbesondere wenn Nutzer:innen (einschließlich Minderjähriger) die tatsächlichen Kosten nicht vollständig erfassen.
Welche Optionen erwägt die Europäische Kommission, um diesen Bedenken zu begegnen?
Mit der Konsultation soll ermittelt werden, ob zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten, um diese Bedenken anzugehen – etwa nicht-regulatorische Maßnahmen (z. B. Leitlinien), neue verbindliche Rechtsvorschriften oder eine effektivere Durchsetzung bestehender Vorschriften. Diesbezüglich fragt die Kommission konkret ab, ob die Teilnehmenden folgende Maßnahmen befürworten:
- Soll der Preis eines In-Game-Gegenstands auch in realer Währung (z. B. Euro) angegeben werden, wenn dieser In-Game-Gegenstand im Austausch gegen In-Game-Währungen (z. B. Münzen oder Diamanten) angeboten wird?
- Soll es mehr Transparenz über die Gewinnwahrscheinlichkeiten geben, wenn In-Game-Gegenstände mittels zufallsbasierter Rewards (z. B. „Lootboxen“) erworben werden?
- Sollen Verbraucher:innen mehr Kontrolle über bestimmte Funktionen digitaler Produkte erhalten, indem sie z. B. die Möglichkeit haben, Funktionen wie die Verwendung von In-Game-Währungen, virtuellen Gegenständen mit zufallsbasierten Rewards oder von Pay-to-Progress- und/oder Pay-to-Win-Mechanismen zu deaktivieren?
- Sollen bestimmte Funktionen digitaler Produkte für Minderjährige verboten werden (und falls ja, welche)?
Zwei dieser vorgeschlagenen Maßnahmen werden wir im Folgenden gesondert betrachten:
a) In-Game-Währungen & Preistransparenz
In-Game-Währungen sind virtuelle Objekte, die in vielen Spielen eingesetzt werden, um ein vielfältiges und spannendes Spielerlebnis zu schaffen. Da sie ein integraler Bestandteil des Spiels sind, teilt die In-Game-Währung auch die rechtliche Natur des Spiels (d. h. digitale Inhalte). Sie kann mithilfe von realem Geld (und/oder manchmal über Gameplay) erlangt und dann im Spiel gegen andere In-Game-Gegenstände eingetauscht werden. Meist wird bei diesem Tausch von einem virtuellen Objekt gegen ein anderes im Spiel kein entsprechender Gegenwert in realem Geld angezeigt. Das führt häufig zu Diskussionen über Preistransparenz und potenziell „entkoppeltes“ Bezahlverhalten.
Beim Eintauschen von In-Game-Währung gegen andere In-Game-Gegenstände besteht derzeit keine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung, den entsprechenden Wert in realem Geld anzuzeigen. Es ist stark umstritten, ob eine solche Verpflichtung nur dann existiert, wenn eine Transaktion stattfindet, d. h., wenn ein Gegenstand im Austausch gegen echtes Geld erworben wird, oder ob In-Game-Währung einem realen Zahlungsmittel gleichzusetzen ist (so genannte digitale Darstellung eines Wertes). Der Tausch von In-Game-Währung gegen In-Game-Gegenstände stellt keine Transaktion dar, sofern es sich lediglich um einen Tausch digitaler Inhalte handelt.
Nationale Rechtsprechung aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, etwa aus Österreich[1], Deutschland[2] und den Niederlanden[3], betont, dass In-Game-Währung nicht als Währung einzustufen ist, sondern als digitaler Inhalt im Sinne der Verbraucherrechte-Richtlinie, da ihr ein tatsächlicher monetärer oder konvertierbarer Wert fehle. Trotz ihres Namens stelle In-Game-Währung weder echte Währung noch eine vergleichbare Größe dar, da sie außerhalb des jeweiligen Spiels nicht nutzbar ist. Rechtlich betrachtet wird die In-Game-Währung seit Jahren als digitaler Inhalt angesehen – allerdings zeichnet sich derzeit ein gewisser Wandel bei der Rechtsdurchsetzung ab, der diese Diskussionen im Zuge des DFA teilweise vorwegnimmt.
Die Kommission fragt, ob der Preis eines In-Game-Gegenstands auch in echter Währung ausgewiesen werden sollte, wenn dieser im Austausch gegen kostenpflichtige In-Game-Währungen (d. h. In-Game-Währungen, die mit realem Geld und nicht über Gameplay erworben wurden) angeboten wird.
b) Nutzerkontrolle & Deaktivierungsoptionen
Ein Kernanliegen der Europäischen Kommission ist, dass Nutzer:innen mehr Kontrolle über digitale Produkte haben sollen, speziell im Hinblick auf integrierte Monetarisierungsmechanismen.
Im geltenden Verbraucherschutzrecht gibt es derzeit keine spezifischen Vorschriften, die die Möglichkeit regeln, bestimmte digitale Elemente zu deaktivieren. Viele der von der Kommission genannten Monetarisierungsmechanismen lassen sich auch jetzt schon freiwillig vom Anbieter konfigurieren, ohne dass eine gesetzliche Verpflichtung besteht – und es steht Verbrauchern auch ohne eine technische Opt-out-Funktion ohnehin frei, diese Mechanismen nicht zu nutzen.
Die Europäische Kommission fragt, ob Nutzer:innen mehr Kontrolle über digitale Produkte haben sollten, indem sie bestimmte Merkmale – beispielsweise den Austausch von In-Game-Währung, zufallsbasierte Rewards oder Pay-to-Progress-/Pay-to-Win-Mechanismen – deaktivieren können.
Eine allgemeine Forderung, bestimmte Mechaniken deaktivierbar zu machen, ist für die Branche mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Aus technischer Sicht lässt sich nicht jede Funktion derzeit modular abtrennen. Darüber hinaus könnte die Abschaltung mancher Elemente – je nachdem, wie eng sie ins Ökosystem eines Spiels eingebunden sind – das Gamedesign oder das gesamte Spielerlebnis grundlegend verändern, und zwar nicht nur für einzelne Nutzer, sondern für alle, die das Spiel spielen.
[1] Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Urteil vom 26. März 2025, 10 Cg 93/23d – 31.
[2] Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 11. Juli 2018 – 6 U 108/16, das die Argumentation des Landgerichts Karlsruhe, Urteil vom 25. Mai 2016 – 18 O 7/16, BeckRS 2016, 12084, bestätigt; obwohl die Entscheidungen vor Inkrafttreten der DCD ergingen, gelten sie weiter für die Auslegung dieser Richtlinie, da ihre Begründung auf der früheren Definition digitaler Inhalte gemäß Art. 2 (11) CRD beruhte, welche nun in Art. 2 (1) DCD enthalten ist.
[3] Gerechtshof Amsterdam, Urteil vom 30. Mai 2023, 21/000312 bis 21/000318, ECLI:NL:GHAMS:2023:1499; später bestätigt durch das Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Urteil vom 26. März 2024, BK-ARN 22/1782, ECLI:NL:GHARL:2024:2166 (fast wortgleich).