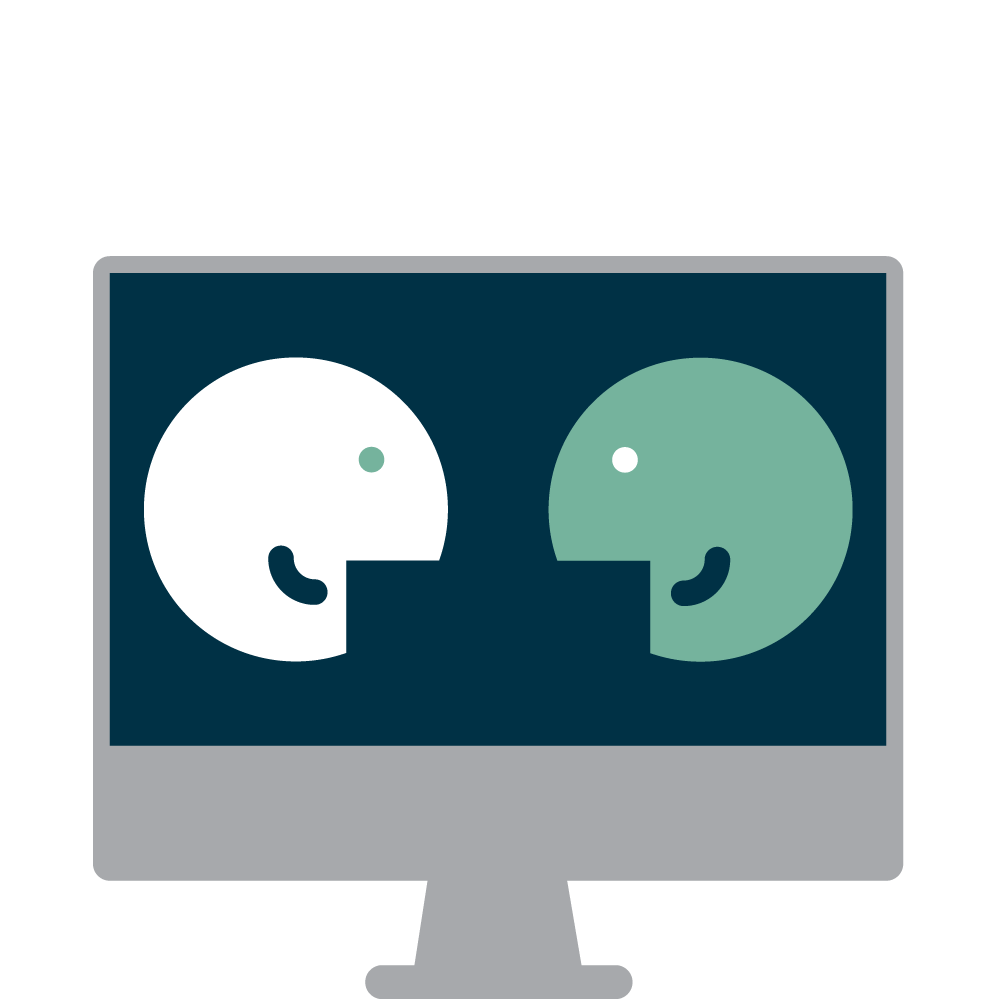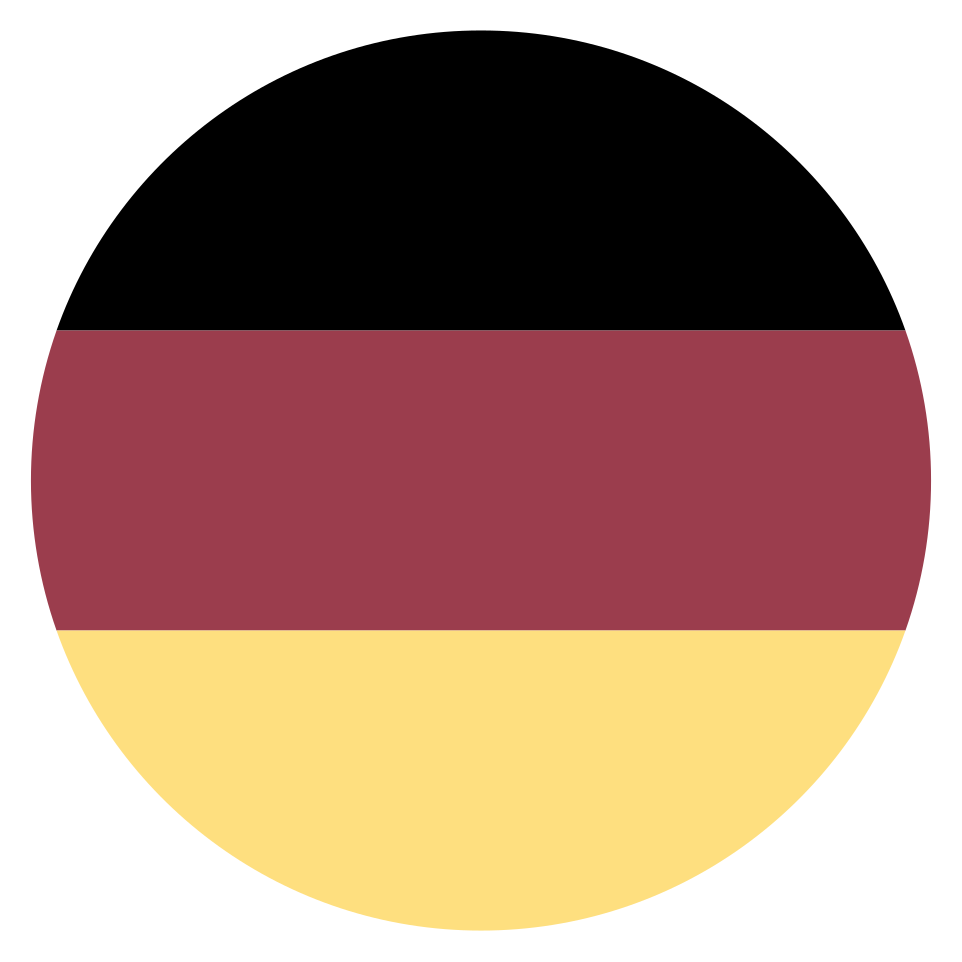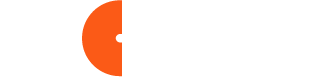Digital Fairness Act Unpacked: Social Media Influencer
Veröffentlicht am 9th September 2025
Am 17. Juli 2025 eröffnete die Europäische Kommission die öffentliche Konsultation zum Digital Fairness Act (DFA). Unternehmen, Verbände und andere Interessenträger können ihre Standpunkte in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Unsere Miniserie befasst sich mit den Themen, die in der Konsultation angesprochen werden. In diesem fünften Teil geht es um Bedenken der Kommission zu Social Media Influencer Marketing und einer möglichen Regulierung.

Was sind laut Konsultation die „schädlichen Praktiken von Social Media Influencern“?
Die Europäische Kommission richtet den Blick auf Praktiken, die durch die zunehmende Bedeutung sozialer Medien für Verbrauchertransaktionen an Gewicht gewinnen:
- Verstecktes Marketing – Influencer:innen kennzeichnen Werbung nicht klar und deutlich als solche.
- Förderung/Verkauf potenziell schädlicher Produkte –etwa Tabak oder Vaping, ungesunde Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, plastische Chirurgie, kosmetische Eingriffe oder die Förderung unrealistischer Schönheitsstandards.
Nach Ansicht der Europäischen Kommission können diese Praktiken Verbraucher- und Minderjährigenschutz beeinträchtigen, weil sie Nutzer:innen – insbesondere Kinder und Jugendliche – durch irreführende Annahmen zu Käufen (auch potenziell schädlicher Produkte) verleiten.
Was ist die aktuelle Rechtslage bezüglich Social Media Influencer?
Handel und Marketing durch Influencer:innen sind derzeit nicht eigens im EU-Verbraucherschutzrecht reguliert. Für Influencer:innen gilt zunächst die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-Richtlinie, Richtlinie 2005/29/EG) bzw. die entsprechende Umsetzung im nationalen Recht. Die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Leitlinien zur Auslegung und Anwendung dieser Richtlinie widmen dem Influencer Marketing einen ganzen Abschnitt (Abschnitt 4.2.6, S. 97 ff.) – ein klares Signal, dass Social Media Influencer wichtige Adressaten sind.
Die Aussagen der Leitlinien im Einzelnen:
- Influencer:innen können Gewerbetreibende oder Personen, die im Namen oder Auftrag des Gewerbetreibenden handeln i. S. d. Art. 2 lit. b UGP-Richtlinie darstellen, insbesondere bei regelmäßigen Werbemaßnahmen gegenüber Verbrauchern.
- Influencer:innen sind natürliche Personen oder virtuelle Einheiten, die eine überdurchschnittliche Reichweite auf einer einschlägigen Plattform haben. Influencer-Marketing ist für Verbraucher:innen häufig schwerer als kommerzielle Werbung zu erkennen, als dies bei andere Formen des Online-Marketings der Fall ist. Selbst wenn Influencer:innen Disclaimer nutzen, verstehen Durchschnittsverbraucher, insbesondere Minderjährige, die Beiträge leicht als persönliche Empfehlung.
- Verstecktes Marketing fällt unter Art. 6 und Art. 7 UGP-Richtlinie: Nach Art. 7 Abs. 2 UGP-Richtlinie muss jeder kommerzielle Zweck der Geschäftspraxis klar kenntlich gemacht werden, sofern er sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt. Nach Anhang I Ziff. 11 UGP-Richtlinie ist Schleichwerbung verboten, bei der bezahlte Werbung als redaktioneller Inhalt erscheint. „Redaktionelle Inhalte“ ist weit zu verstehen und umfasst auch Influencer-Posts. Fehlende Offenlegung kann zudem gegen Anhang I Ziff. 22 UGP-Richtlinie(Täuschendes Auftreten als Verbraucher) verstoßen.
- Die Offenlegung muss klar und angemessen erfolgen, insbesondere im Hinblick auf Kontext, Platzierung, Zeitpunkt, Dauer, Sprache und Zielgruppe. Die Offenlegung muss an auffälliger Stelle erscheinen. Unzureichend ist die Offenlegung an unauffälliger Stelle, z. B. erst in Hashtags am Ende eines langen Haftungsausschlusses oder wenn der Verbraucher erst auf „Weiterlesen“ klicken muss.
- Jede einzelne kommerzielle Kommunikation muss gekennzeichnet sein – auch bei umfassenden Rahmen-Werbevereinbarungen.
- Ein kommerzieller Zweck liegt bei jeder Form der Gegenleistung vor, z. B. Geld, Rabatte, Partnerschaftsvereinbarungen, Prozente aus Affiliate-Links, Gratisprodukte (auch unaufgeforderte Geschenke!), Reisen oder Einladungen zu Veranstaltungen – unabhängig davon, ob ein formeller Vertrag geschlossen wurde oder eine Geldzahlung erfolgt. Wichtig: Nicht nur die Influencer:innen haften für ihre Verstöße, sondern gegebenenfalls auch beauftragende oder profitierende Gewerbetreibende bzw. Markeninhaber (Art. 5 UGP-Richtlinie – berufliche Sorgfalt). Eine redaktionelle Kontrolle kann dieses Risiko erhöhen, ist aber kein Erfordernis für eine Haftung. Influencer:innen haften, sobald sie als Gewerbetreibende eingeordnet werden (s. o.).
- Die gleichen Regeln gelten auch für Influencer:innen, die ihre eigenen Produkte oder ihr eigenes Unternehmen bewerben. Sie müssen den kommerziellen Zweck offenlegen und dürfen kein nichtgewerbliches Handeln oder eine Verbrauchereigenschaft vortäuschen (Anhang I Ziff. 22 UGP-Richtlinie).
- Aggressive Geschäftspraxis durch unzulässige Beeinflussung nach Art. 8 und Art. 9 UGP-Richtlinie können vorliegen, wenn Influencer:innen eine missbräuchliche Vertrauensbeziehung oder persönliche Verbindung aufbauen – insbesondere bei schutzbedürftigen Zielgruppen wie Minderjährige.
- Direkte Kaufaufforderungen an Kinder sind ausnahmslos verboten (Anhang I Ziff. 28 UGP-Richtlinie).
- Auch Online-Plattformen, die für die Verkaufsförderung genutzt werden, unterliegen diesen Verpflichtungen und haben darüber hinaus eigene berufliche Sorgfaltspflichten nach der UGP-Richtlinie. Sie müssen Drittanbietern ermöglichen, deren Verpflichtungen aus dem EU-Recht nachzukommen, z. B. durch die Bereitstellung von Tools zur Offenlegung auf der Benutzeroberfläche (Art. 28b Abs. 3 lit. c der AVMD-Richtlinie, Richtlinie 2010/13/EU).
Darüber hinaus gelten auch die bestehenden Vorschriften über vorvertragliche Informationen, Marketing und Vertragsbedingungen für Social Media Plattformen – neben der AVMD-Richtlinie insbesondere die E-Commerce-Richtlinie (Richtlinie 2000/31/EG) und der DSA (Verordnung 2022/2065/EU). Teils sind neben den Plattformen auch Influencer:innen direkt verpflichtet.
Im Einzelnen:
- DSA und die AVMD-Richtlinie verschärfen die Anforderungen an die Transparenz von Werbung.
- DSA: Plattformen müssen Funktionen zur Kennzeichnung kommerzieller Inhalte bereitstellen (Art. 26 Abs. 2). Rechtswidrige Inhalte (z. B. bei Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente nach Art. 9 Abs. 1 lit. f der Richtlinie 2018/1808/EU und Art. 88 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 2001/83/EG über Humanarzneimittel), müssen leichter zu melden und zu entfernen sein (insbesondere Art. 16 DSA). Neue Verbote für Inhalte, die von Influencer:innen geteilt werden können, enthält der DSA nicht.
- AVMD-Richtlinie: Durch die Novelle aus 2018 (Richtlinie 2018/1808/EU) wurden die zusätzlichen Vorschriften für Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattformen zur Offenlegung kommerzieller Kommunikation eingeführt (Art. 28a und Art. 28b). Zudem wurde spezifische Werbeverbote festgelegt (u.a. für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten, verschreibungspflichtige Arzneimittel, Alkohol an Minderjährige und gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen, Art. 9 Abs. 1). Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen vor schädlichen Inhalten wurden verstärkt (Art. 9 Abs. 1, Art. 28b Abs. 1). Zugleich müssen Nutzer, die nutzergenerierte Videos hochladen, angeben, ob diese kommerzielle Kommunikation enthalten (Art. 9 Abs. 1, Art. 28b Abs. 1). Die Mitgliedstaaten sind auch verpflichtet, die Koregulierung und Selbstregulierung zu fördern, z. B. in Bezug auf die Werbung für ungesunde Lebensmittel an Minderjährige (Art. 9 Abs. 4). Diese Vorschriften können direkt auf Influencer:innen angewandt werden, wenn sie als audiovisuelle Mediendienste gelten. Dafür müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. eine bedeutende wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die redaktionelle Kontrolle über die von ihnen bereitgestellten Inhalte haben und die breite Öffentlichkeit als Zielgruppe haben.
- Zudem haben mehrere Mitgliedstaaten, auch unter Nutzung der AVMD-Vorschriften für Influencer:innen, Gesetze und Leitlinien verabschiedet oder aktualisiert, die Definitionen und spezifische Verpflichtungen für Influencer:innen und Händler, die mit ihnen zusammenarbeiten, enthalten. Es wurde z. B. mit einem französischen Gesetz im Juni 2023 (Gesetz Nr. 2023-451), geändert im November 2024 (Order No 2024-978), u. a. ein Verbot des Influencer-Marketings in Bezug auf plastische Chirurgie/Injektionen, pharmazeutische Produkte und Medizinprodukte, Nikotin, bestimmte Finanzanlagen (z. B. Kryptowährungen) und Wildtiere eingeführt. Glücksspiele und Sportwetten/Prognosen sind erlaubt, sofern der Zugang für Minderjährige beschränkt ist. Weitere Beispiele für einschlägige nationale Rechtsvorschriften sind die Änderungen des deutschen Rechts aus dem Jahr 2022, die die Vermutung einer Vergütung für die kommerzielle Kommunikation begründen, sofern die Influencer:innen nicht das Gegenteil beweisen (§ 5a Abs. 4 S. 3 UWG). In Deutschland gilt für geschäftsmäßig auftretende Influencer:innen die Pflicht zur Anbieterkennzeichnung/Impressum (z. B. nach § 5 DDG). Auch in Italien steht das Thema Influencer stark im Fokus. Am 23. Juli 2025 hat die italienische Kommunikationsbehörde (die sogenannte „AGCOM“) die Leitlinien (die „Leitlinien“) offiziell verabschiedet, um die Einhaltung der nationalen Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie; engl. AVMSD) sowie des Verhaltenskodex für Influencer (der „Kodex“) durch Influencer:innen sicherzustellen. Die Leitlinien und der Kodex gelten für die sogenannten „relevanten“ Influencer:innen, also diejenigen, die auf mindestens einer Social-Media- oder Video‑Sharing‑Plattform mindestens 500.000 Follower haben oder auf einer solchen Plattform durchschnittlich mindestens eine Million monatliche Aufrufe erzielen (die „Influencer“). Zum einen benennen die Leitlinien die Vorschriften der nationalen Umsetzung der AVMD-Richtlinie (Gesetzesdekret Nr. 208 vom 8. November 2021), die auf Influencer:innen Anwendung finden. Neben den allgemeinen Grundsätzen zur Information gibt es Bestimmungen zum Urheberrecht, zum Schutz der Grundrechte des Einzelnen, von Minderjährigen und der Werte des Sports sowie über kommerzielle Kommunikation. Zum anderen legt der Kodex zusätzliche Maßnahmen und technische Vorkehrungen fest, um die Einhaltung der Vorschriften der nationalen Umsetzung der AVMD-Richtlinie sicherzustellen, im Einklang mit den in den Leitlinien festgelegten Grundsätzen und Kriterien und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Dienstes sowie der Plattform oder des sozialen Mediums, über das er verbreitet wird. Sowohl die Leitlinien als auch der Kodex sehen Sanktionen für den Fall der Nichteinhaltung vor. Bemerkenswerterweise integriert der Kodex die sogenannte „Digital Chart“, ein Soft‑Law‑Instrument, das vom italienischen Werbe‑Selbstregulierungsorgan ausgearbeitet wurde. Folglich ist die Digital Chart auf Influencer:innen vollumfänglich anwendbar und ihnen gegenüber durchsetzbar.
Auch im Bereich der Finanzdienstleistungen könnten Influencer:innen bald Adressaten neuer Regelungen werden: Die Kommission schlug dafür im Jahr 2023 eine Überarbeitung der Vorschriften zum Schutz von Kleinanlegern vor. Diese neuen Regelungen sollen Transparenz- und Fairnessanforderungen für die Marketingkommunikation und -praktiken enthalten, die sicherstellen, dass die Offenlegung von Werbung und die Anforderungen an Influencer:innen klar und einheitlich geregelt sind, um Rechtsunsicherheit und regulatorische Fragmentierung zu vermeiden. Allerdings sind bisher die Ergebnisse dieser Verhandlungen nicht absehbar.
Was diskutiert die Europäische Kommission?
Mit der Konsultation soll ermittelt werden, ob zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollten, um diese Bedenken anzugehen – etwa nicht-regulatorische Maßnahmen (z. B. Leitlinien), neue verbindliche Rechtsvorschriften oder eine effektivere Durchsetzung bestehender Vorschriften. Diesbezüglich fragt die Kommission konkret ab, ob die Teilnehmenden folgende Maßnahmen befürworten:
- Sollen Influencer:innen Werbung klar und deutlich offenlegen?
- Sollen Marken und Agenturen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Influencer:innen die rechtlichen Verpflichtungen einhalten?
- Sollen bestimmte Arten von Aussagen von Influencer:innen zum Schutz von Minderjährigen eingeschränkt werden, z. B. Behauptungen über ungesunde Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, plastische Chirurgie, kosmetische Eingriffe, Tabak/Vaping-Liquids oder die Förderung unrealistischer Schönheitsstandards (z. B. durch retuschierte oder KI-generierte Bilder, die in der Werbung verwendet werden und bei denen die Körperform, die Größe oder das Hautbild verändert wurden)?
Einordnung der angedachten Regulierungsansätze
Die in der Konsultation aufgeworfenen Bedenken sind im Kontext zu einem Fitness Check der Kommission zu verstehen. Diesem Zufolge (S. 169 ff.) belegen zahlreiche Studien und Durchsetzungsmaßnahmen, dass viele Influencer diese Offenlegungspflichten in sozialen Medien nicht einhalten.
Die Kommission beobachtet eine fehlende Transparenz in Bezug auf bezahlte Produktwerbung durch Influencer:innen. Auch wenn Disclaimer verwendet werden, ist Influencer-Werbung oft nicht eindeutig als solche identifiziert und Verbraucher verstehen Inhalte zumindest teilweise als persönliche Empfehlung.
Der Fitness Check äußert zudem Bedenken hinsichtlich verschiedener Praktiken, die für die Verbraucher ein Risiko darstellen können: So haben Influencer:innen etwa für Betrug oder gefährliche Produkte geworben. Kinder sind aggressivem Marketing für ungesunde Lebensmittel und Getränke, Alkohol oder Vaping ausgesetzt sind – mit möglicherweise gefährlichem Einfluss auf ihr Verhalten.
Zwar existieren nationale Gesetze und Leitlinien von Mitgliedstaaten wie Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande und Dänemark, die jedoch – wie die Leitlinien zur UGP-Richtlinie – nicht immer verbindlich sind. Diesbezügliche Rechtsprechung des EuGH fehlt. Das schafft Rechtsunsicherheit, etwa über Verantwortlichkeiten entlang der Wertschöpfungskette, insbesondere bei Marken, die Influencer:innen zur Bewerbung ihrer Produkte und Dienstleistungen einsetzen.
Spezifische Verbote für Influencer:innen, bestimmte Produkte zu bewerben, fehlen, abgesehen von AVMD- und anderen sektorspezifischen Regeln. Der Fitness Check warnt vor einer regulatorischen Fragmentierung.
Insgesamt ist daher nach dem Fitness Check trotz der seit langem bestehenden Regeln in der UGP-Richtlinie, der Rechtsrahmen in Bezug auf versteckte Werbung unzureichend. Denn trotz Durchsetzungsmaßnahmen der Behörden und Selbstregulierungsmaßnahmen wie das Influencer Legal Hub, das Influencer:innen, Werbetreibenden, Agenturen und Marken grundlegende Anleitungen zur Einhaltung des EU-Verbraucherrechts an die Hand geben soll, besteht jedoch nach wie vor eine erhebliche Rechtsunsicherheit hinsichtlich des erforderlichen Standards und der Modalitäten für die Offenlegung von Anzeigen. Verschiedene Gerichte, Behörden, nationale Gesetze und Leitlinien legen Aspekte wie die genaue Formulierung und die erforderliche optische Hervorhebung unterschiedlich aus. So heißt es in den UGP-Leitlinien zwar, dass volle Transparenz auch dann erforderlich ist, wenn Influencer:innen für ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen werben, der BGH in Deutschland entschied jedoch, dass der kommerzielle Zweck in solchen Fällen, in denen Influencer:innen für ihr eigenes Unternehmen werben, sich bereits aus den Umständen ergibt und die besondere Kenntlichmachung somit nicht erforderlich ist (BGH, Urteil vom 9. September 2021, Az. I ZR 125/20).
Daher stellt das EU-Verbraucherrecht zwar eine allgemeine Rechtsgrundlage für die Bewältigung von Transparenzproblemen im Zusammenhang mit Influencer-Marketing dar, aber laut Fitness Check ist es derzeit nicht präzise genug, um alle durch den Social-Media-Handel aufgeworfenen Probleme anzugehen, was zu einem Risiko der regulatorischen Fragmentierung und Rechtsunsicherheit beiträgt. Aus diesen Gründen erscheint eine neue Regulierung hinsichtlich Social Media Influencern und ihres Marketings sinnvoll, um die problematischen kommerziellen Praktiken in den sozialen Medien einheitlich gebündelt und damit rechtssicher für alle zu regeln.