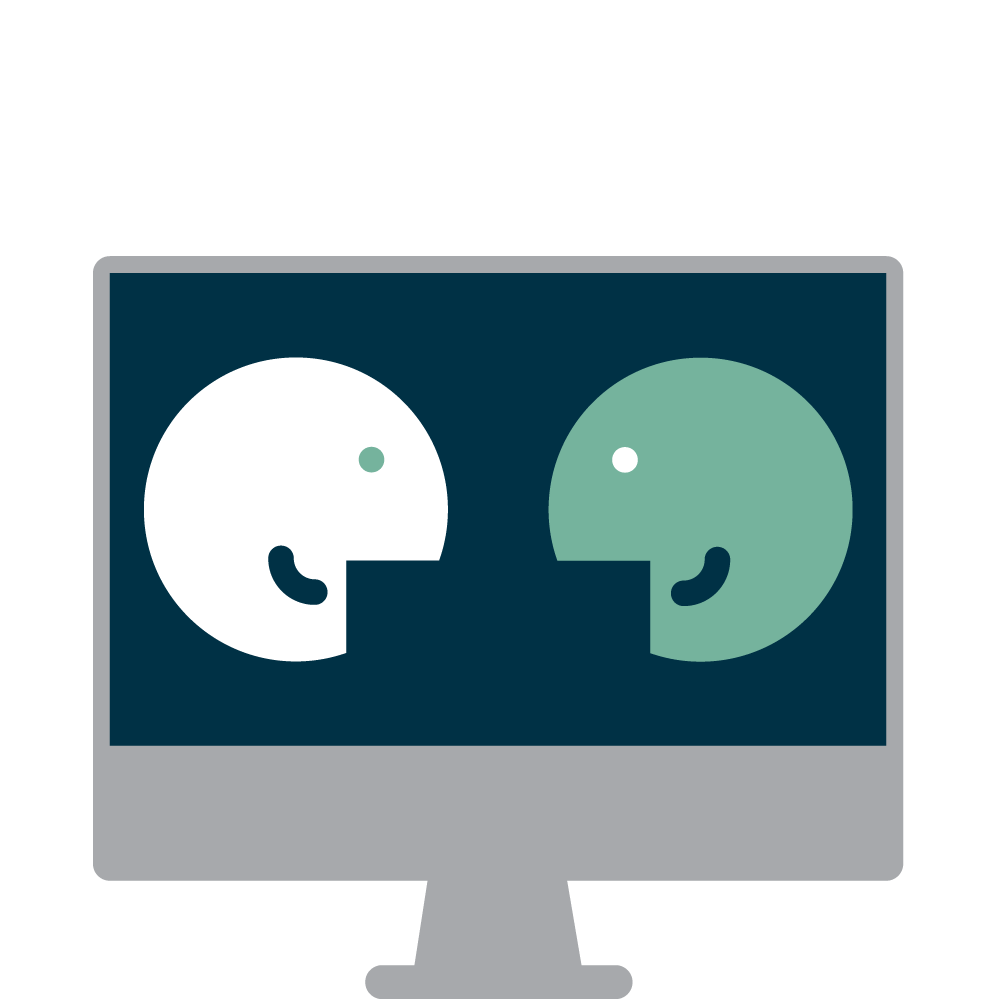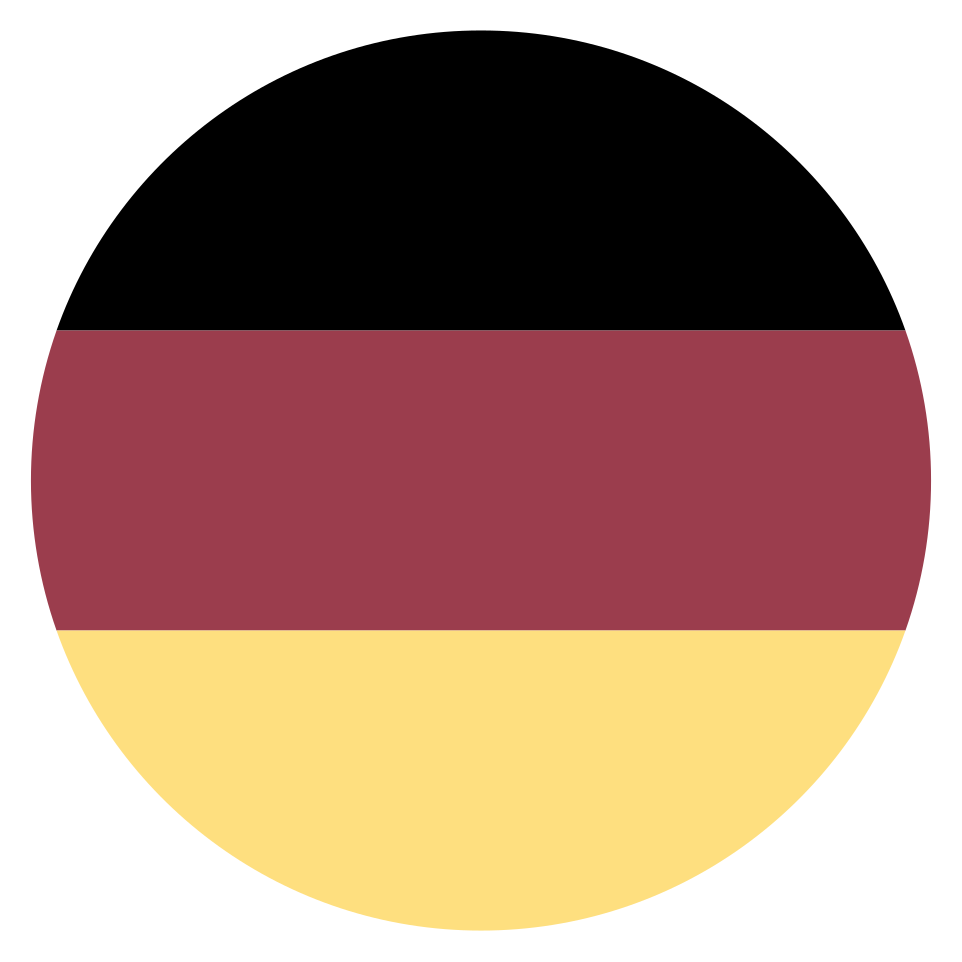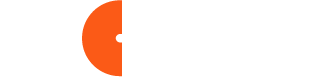„Dubai-Schokolade“ – geografische Herkunft, bloßes Marketing oder „Rezept“?
Veröffentlicht am 25th Juli 2025
Das OLG Köln (Urteile vom 27.06.2025 - 6 U 52/25, 6 U 53/25, 6 U 58/25, 6 U 60/25) hat entschieden: Die Bezeichnung „Dubai-Schokolade“ wird (noch) als geografischer Herkunftshinweis verstanden – und ist damit irreführend und unzulässig, wenn das Produkt nicht aus Dubai stammt (§ 127 Abs. 1 MarkenG). Bereits zuvor hatten Landgerichte über ähnliche Konstellationen zu entscheiden – mit teils abweichender Bewertung. Das hat u.a. LTO dargestellt. Was bedeutet das?

Ursprung des Hypes und die geografische Herkunft
Maßgeblich für das OLG Köln war, dass der Ausgangspunkt des Hypes Produkte gewesen seien, die tatsächlich in Dubai hergestellt worden seien. Das OLG leitet das Ergebnis, dass es eine Herkunftsangabe sei, zunächst her aus dem Wort „Dubai“, was „grundsätzlich so lange als Ursprungsbezeichnung anzusehen“ sei, als nicht zweifelsfrei ihre Bestimmung lediglich als von der (örtlichen) Herkunft losgelöste Beschaffenheitsangabe oder reine Fantasiebezeichnung feststeht (und verweist auf BGH GRUR 1963, 482, 484 – Hollywood Duschschaumbad).
Einfluss von Influencern und Luxusverbindung
Der Hype habe außerdem seinen Ursprung in Dubai genommen, wobei die Bekanntheit in Deutschland durch Influencer ihren Lauf genommen habe, die die Schokolade in Dubai probiert hätten. Hinzu kämen die anfangs sehr hohen Preise für die Schokolade und die eingeschränkte Verfügbarkeit, was eine Verbindung zu Luxus und zu Dubai herstelle. Weitere Aspekte wie die bildliche Darstellung des Burj al-Arab oder des Burj Khalifa verstärken die Herkunftsangabe.
Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung
An die Umwandlung einer geografischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung werden strenge Anforderungen gestellt. Sie liegt erst vor, wenn ein nur noch ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht (10-15 % wird oft als Richtschnur gesehen).
Erste Marktreaktionen sind auch bereits ersichtlich: Immer häufiger wird „Dubai Style“-Schokolade gesichtet; der Markt versucht also, die weiter bestehende Unsicherheit zu umgehen.
Herkunftserwartung und empirischer Prozess
Für die nachfolgenden Überlegungen sind die Rn. 36 des Urteils zum Az. 6 U 52/25 zentral. Das OLG Köln meint: Die Herkunftserwartung bleibe bestehen – und könne nicht einfach durch einen Trend (= viele andere „Dubai“-Schokoladen) „wegargumentiert“ werden. Ein Bedeutungswandel hin zur Gattungsbezeichnung sei regelmäßig ein langsamer, empirisch nachvollziehbarer Prozess, der hier noch nicht eingetreten sei. Woher weiß das OLG Köln das? Woher weiß es, dass dieser empirisch nachvollziehbare Prozess noch nicht abgelaufen ist? Die Antwort in Rn. 38: „Diese Feststellung kann der Senat wiederum selbst treffen.“
Verbraucherauffassung und Rezeptur
Doch es lässt sich beobachten, dass viele deutsche Verbraucher die Benennung der Schokolade nicht als Herkunftsangabe verstehen, etwa, weil nur die wenigsten wissen, wo die erste Dubai-Schokolade herkam. Fragt man, was Dubai-Schokolade sei, wird das Produkt wesentlich häufiger durch seine Zutaten als seine Herkunft beschrieben. Das LG (referenziert in Rn. 39 der OLG Köln Entscheidung) hat ebenso angenommen, dass es dem Durchschnittsverbraucher in erster Linie auf die Rezeptur ankomme. Der Einwand der Antragsgegnerin, wonach eine tatsächlich aus Dubai stammende und als „Dubai-Schokolade“ bezeichnete Schokolade z. B. mit der Geschmacksrichtung Marzipan vom Verbraucher gerade nicht als Dubai-Schokolade angesehen werde, weil die Rezeptur untrennbar mit dem Begriff verbunden sei, hat das OLG Köln im Ergebnis nicht überzeugt (Rn. 42).
Vergleich zur Rechtsfindung in UK oder den USA
Die Schnelligkeit und Effizienz deutscher Gerichtsverfahren, gerade in einstweiligen Verfügungsverfahren, wird geschätzt. Das beruht auch darauf, dass Gerichte selbst etwa die Irreführung von Werbung oder eine Verwechslungsgefahr im Markenrecht wie das OLG Köln beurteilen. Allerdings geht es doch eigentlich um die Sichtweise des Verkehrs. Die festzustellen, ist (zeit-)aufwändig und teuer. Aber würde sie stärker zur Wahrheitsfindung beitragen?
Harmonisierter Begriff des Durchschnittsverbrauchers
Ein Urteil des BGH geht noch weiter: Der zusammengefasste fünfte Leitsatz zum Beschluss des BGH vom 20. Februar 2025 – I ZB 26/24 (GRUR 2025, 848) lautet: Die nationalen Gerichte dürfen wegen des harmonisierten Begriffs des Durchschnittsverbrauchers nicht nur beurteilen, ob eine Werbeaussage irreführend ist, sondern auch, dass sich die Anschauungen des Durchschnittsverbrauchers in einem anderen Mitgliedstaat nicht entscheidungserheblich von denen des deutschen Durchschnittsverbrauchers unterscheiden.
Fazit: Verkehrsverständnis und Prozessrecht
Deutsche Gerichte sollen also nicht nur das deutsche Verkehrsverständnis kennen, sondern das EU-weite – aber ist das so? Der Fall „Dubai-Schokolade“ könnte als Denkanstoß dienen, ob dies tatsächlich der Realität entspricht. Dabei betrifft dieser Grundsatz weniger das Ergebnis des OLG Köln oder des BGH, sondern mehr das Prozessrecht allgemein und vor allem im Bereich IP, wo so häufig das Verkehrsverständnis entscheidet.