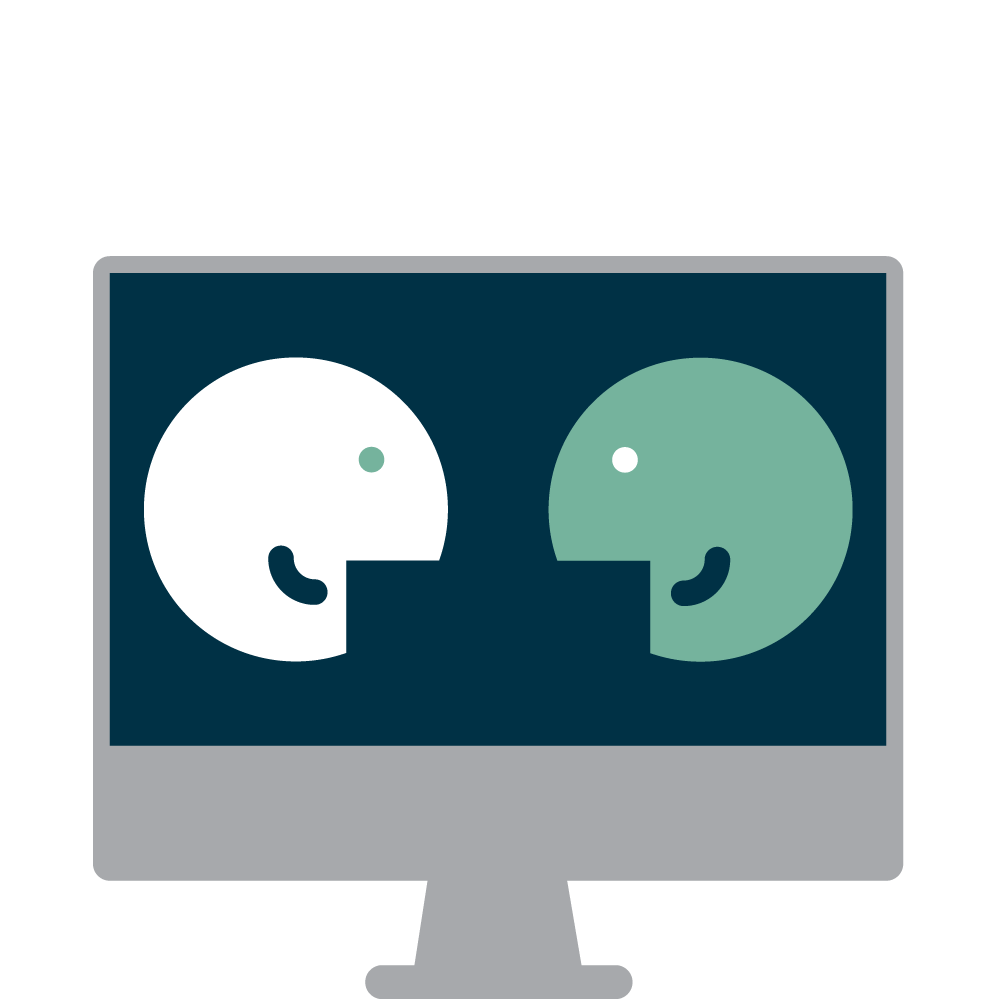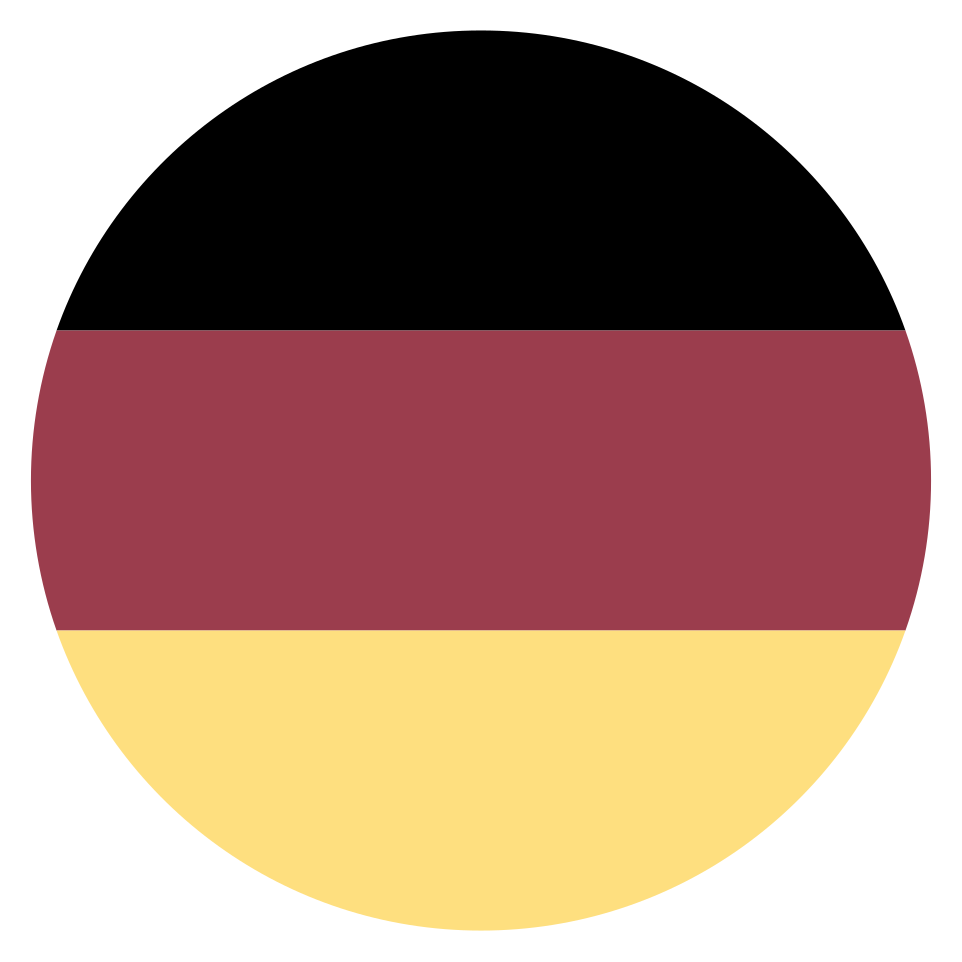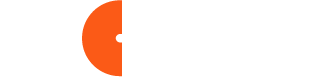Zwischen Regel 40.2 und 50.2: Der Fall Manizha Talash und die Grenzen der Meinungsäußerung im Kontext der olympischen Spiele
Veröffentlicht am 27th Oktober 2025
Zwischen Meinungsfreiheit und Propagandaverbot: Der Fall Manizha Talash legt die Bruchlinien im IOC-Regelwerk offen. Mit „Free Afghan Women“ setzte die afghanische Athletin ein klares Menschenrechtsstatement – und wurde postwendend disqualifiziert. Im Lichte von Regel 40.2 und 50.2 der IOC‑Charta geht es nun um die Grenzen zulässiger Ausdrucksformen, um Gleichbehandlung und um die Frage, wie Sportverbände ihre Verantwortung für Menschenrechte mit der Integrität des Wettkampfs in Einklang bringen können.

Etwas unter dem Radar angesichts der eindeutigen Entscheidung der Münchenerinnen und Münchener für die Olympiabewerbung fliegt aktuell ein weiteres spannendes sportrechtliches Thema: Während die Münchener ein erstes starkes Zeichen gesetzt haben, damit die olympische Fackel nach 1972 erneut im Olympiastadion aufleuchten kann, flammt ein anderer sportrechtlicher Dauerbrenner wieder auf: Meinungsäußerungen von Athleten, insbesondere während des Wettkampfes oder der Siegerehrung. Zwar ist der Protest von John Carlos und Tommie Smith für die Rechte der Schwarzen bei den Olympischen Spielen 1966 das wohl immer noch bekannteste Beispiel, unzählige bekannte Sportler wie Colin Kaepernick folgten ihrem Beispiel und setzen Zeichen für bestimmte politische oder gesellschaftliche Anliegen.
Worum geht es nun in dem neuen Anwendungsfall?
Konkret geht es nun eine Meinungsäußerung der afghanischen Breakdancerin Manizha Talash, die während ihres olympischen Wettkampfes in Paris 2024 ein Zeichen gegen die anhaltende, verheerende Unterdrückung von Frauen durch das Taliban Regime in ihrer Heimat setzte. Talash, die offizell für das Team der Geflüchteten des IOC an den Start gegangen war, rollte während ihrer Performance einen Umhang mit der Aufschrift "Free Afghan Women" aus. Dafür wurde die Athletin von der World DanceSport Federation von dem olympischen Wettkampf nachträglich disqualifiziert.
Welches rechtliche Spannungsfeld offenbart sich hier?
- Hintergrund ist, dass nahezu alle relevanten Weltsportverbände wie IOC und FIFA und die sich ihnen angeschlossenen kontinentalen und nationalen Sportverbände spezifische Regeln geschaffen haben, um Meinungskundgaben von Athleten und anderen den Regelunterworfenen in bestimmten Situationen wie dem Wettkampf zu verbieten oder an Bedingungen zu knüpfen. Das Ziel derartiger sehen Sportverbände offiziell insbesondere darin, die Integrität und Würde des Wettkampfes sowie Wettbewerber zu schützen. Die „Mutter aller Regeln“ ist wohl die Regel 50.2 der IOC-Charta. In der englischen Fassung lautet sie: "No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas."
- Weitere Konkretisierung soll die Regel 50.2 durch die im Anschluss abgedruckte „Bye-law to Rule 50“ erfahren. Diese wiederum nimmt Bezug auf sog. Guidelines: In der Bye-law heißt es dazu: „[…] The IOC Executive Board shall adopt guidelines that provide further details on the implementation of this principle. Any violation of this Bye-law 1 and the guidelines adopted hereunder may result in disqualification of the person […].”
- Die in Form eines Q&A Formats gestalteten „Guidelines on Athlete Expression – Olympic Games Paris 2024“ sollen weitere Orientierung bieten. Die unter Mitwirkung der IOC-Athletenkommission verabschiedeten Richtlinien kamen erstmals im Zuge der Olympischen Spiele in Tokio 2021 zum Einsatz und wurden seitdem weiter überarbeitet. Dennoch enthalten sowohl die Regel 50.2 als auch die Bye-Law und die Guidelines weiterhin interpretationsbedürftige Begriffe. Abschließende Definitionen fehlen.
- Zusätzlich zu diesen bereits komplexen und für Athleten nur schwer ohne rechtlichen Beistand zu durchdringenden Regeln hat das IOC im Rahmen der 141. IOC-Session im Oktober 2023 entscheidende Änderungen seiner IOC-Charta verabschiedet. Ziel des IOC war es, seine Verantwortung zum Schutz der Grund- und Menschenrechte in seinem Zuständigkeits- und Einflussbereich zu konkretisieren. Die Änderungen sind ein erster Meilenstein im Rahmen eines umfassenden Prozesses, der maßgeblich auf dem IOC Strategic Framework on Human Rights beruht. Dieses Dokument hat das IOC nach Konsultation mit führenden Menschenrechtsexperten wie Rachel Davis und Prince Zeid Ra'ad Al Hussein gewissermaßen den Fahrplan des IOC-Reformprozeses dar.
- Das IOC hat explizit in den Grundprinzipien eins und fünf des Olympismus nun ein ausdrückliches Bekenntnis zu den international anerkannten Menschenrechten in die IOC-Charta aufgenommen, auch wenn keine abschließende Aufzählung der damit gemeinten Menschenrechtskataloge einhergeht. Daneben hat das IOC nun eine weitere Vorschrift in der IOC-Charta verankert, die explizit auch der Meinungsäußerungsfreiheit zunehmendes Gewicht verleiht. Mit der neuen Regel 40.2 stärkt das IOC das Recht der Meinungsäußerungsfreiheit wie folgt: “All competitors, team officials or other team personnel in the Olympic Games shall enjoy freedom of expression in keeping with the Olympic values and the Fundamental Principles of Olympism, and in accordance with the Guidelines determined by the IOC Executive Board.”
- Das IOC selbst erkennt damit die Bedeutung und das Gewicht der Meinungsäußerungsfreiheit für Athleten und andere Regelunterworfene explizit an. Die damit einhergehende spezifische Selbstbindung des IOC lässt die Frage in den Hintergrund treten, ob und unter welchen Umständen die Meinungsäußerungsfreiheit (z.B. gemäß Artikel 10 EMRK oder Artikel 5 Absatz 1 S. 1 Variante 1 GG) auch im Verhältnis von Sportverbänden und Athleten unmittelbar Wirkung entfalten kann.
Der konkrete Fall stellt das reformierte Regelungssystem des IOC auf nun die Probe. Es stellen sich verschiedene spannende Rechtsfragen, die teilweise von Schiedsgerichten noch staatlichen Gerichten entschieden wurden.
- Ohne die Klageschrift der Athletin zu kennen, stellt sich vorab z.B. die Frage, ob die Athletin gegen die sofortige Disqualifikation nicht bereits vor der in Einklang mit Artikel 61 der IOC-Charta installierten CAS ad-hoc Division für Paris hätte vorgehen müssen. Des Weiteren ist fraglich, ob die Athletin sowohl gegen das IOC als Veranstalter der Olympischen Spiele als auch die für sie zuständigen World DanceSport Federation vorgehen kann.
- Auch materiellrechtlich stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die neue Regel 40.2 der IOC-Charta inklusive der sie ergänzenden Guidelines und die bereits existierende restriktive Regel 50.2 der IOC-Charta stehen. Ohne gerichtliche Klärung oder entscheidende Konkretisierung auslegungsbedürftiger Begriffe stehen IOC und internationale Sportfachverbände vor der Herausforderung, auf Einzelfallbasis derartige Fälle entscheiden zu müssen. Sie setzen sich damit leicht dem Vorwurf aus, vergleichbare Fälle ohne sachliche Rechtfertigung ungleich zu behandeln. Damit berührt der Fall unter Umständen zugleich auch das ebenfalls in der IOC-Charta mehrfach zum Ausdruck gebrachte Diskriminierungsverbot. Regelunterworfene könnten so von der Wahrnehmung ihrer auch durch das IOC gewährten Rechte abgeschreckt werden.
- Es bleibt abzuwarten, ob die Prozessbevollmächtigte der Athletin die zunehmend in den Fokus gerückten kartellrechtlichen Verbotsnormen wie Art. 101 und 102 AEUV bemühen wird, um zu argumentieren, dass ein Ausschluss auf Basis einer möglicherweise nicht hinreichend transparenten, diskriminierungsfreien Vorschrift auch kartellrechtlich zu beanstanden ist. Dazu wäre die Anrufung eines staatlichen Gerichts eines Mitgliedstaates oder einer mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörde zu prüfen.
- Über den konkreten Fall hinaus hat sich unser Experte, Dr. Michael Kintrup, im Rahmen seiner Anfang des Jahres in der Reihe #SchriftenzumSportrecht erschienenen Doktorarbeit neben den hier angerissenen Fragen auch damit befasst, ob sich unter Heranziehung der Stadionverbots-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 148, 267) eine staatliche Schutzpflicht zur Gewährleistung kommunikativer Chancengleichheit von Athleten im Kontext von Sportwettbewerben herleiten lässt. Zusätzlich diskutiert er in dem Buch, wie sich die jüngsten Reformen des IOC zur Stärkung der Rechte der Athleten zu der vielfach kritisierten „The Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration“ verhalten.
- Die komplexen Rechtsfragen an der Schnittstelle des Völker- und Verfassungsrechts und des Sportrechts sind weiterhin brandaktuell. Denn auch der am Freitag erschienene Referententwurf eines Sportfördergesetzes, mit dem die aktuelle Regierung das an der Diskontinuität des Bundestags gescheiterte Projekt der Ampel-Koalition aufgreift, dient unter anderem der Stärkung der Rechte und der Absicherung deutscher Spitzenathletinnen und -athleten.