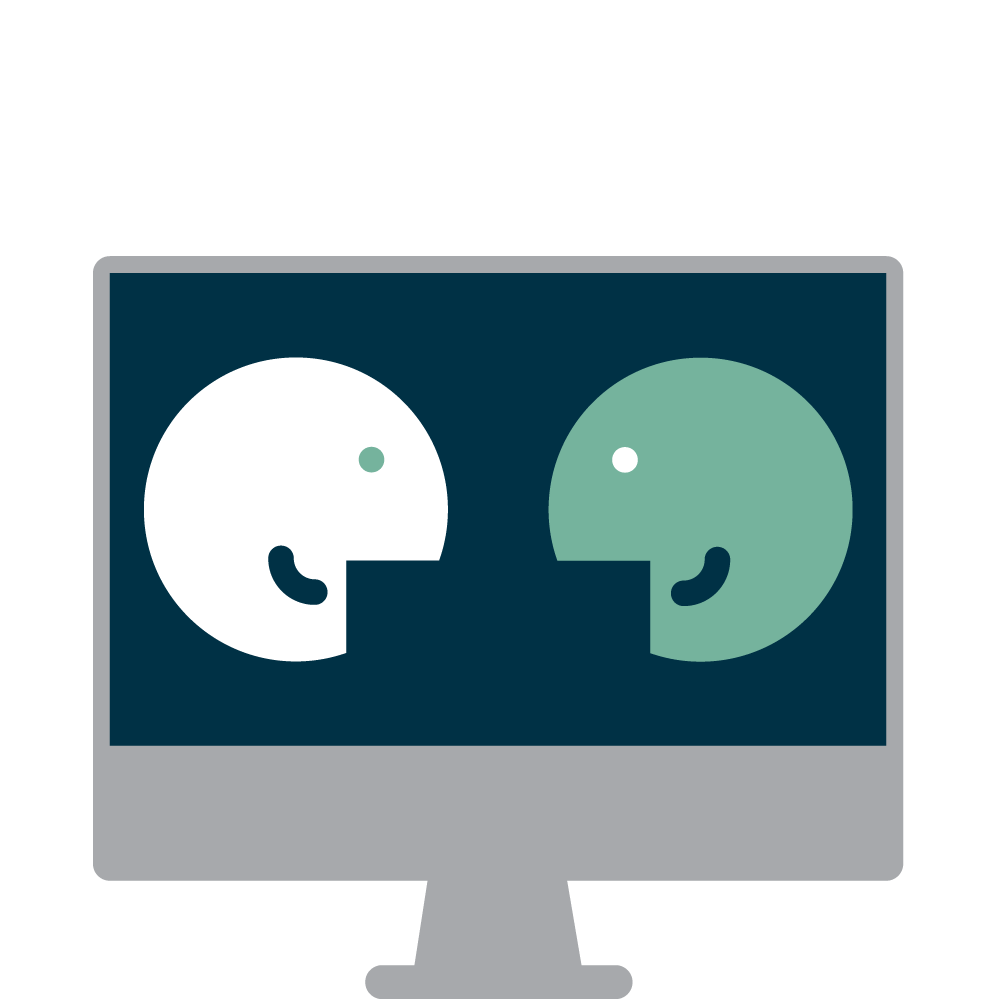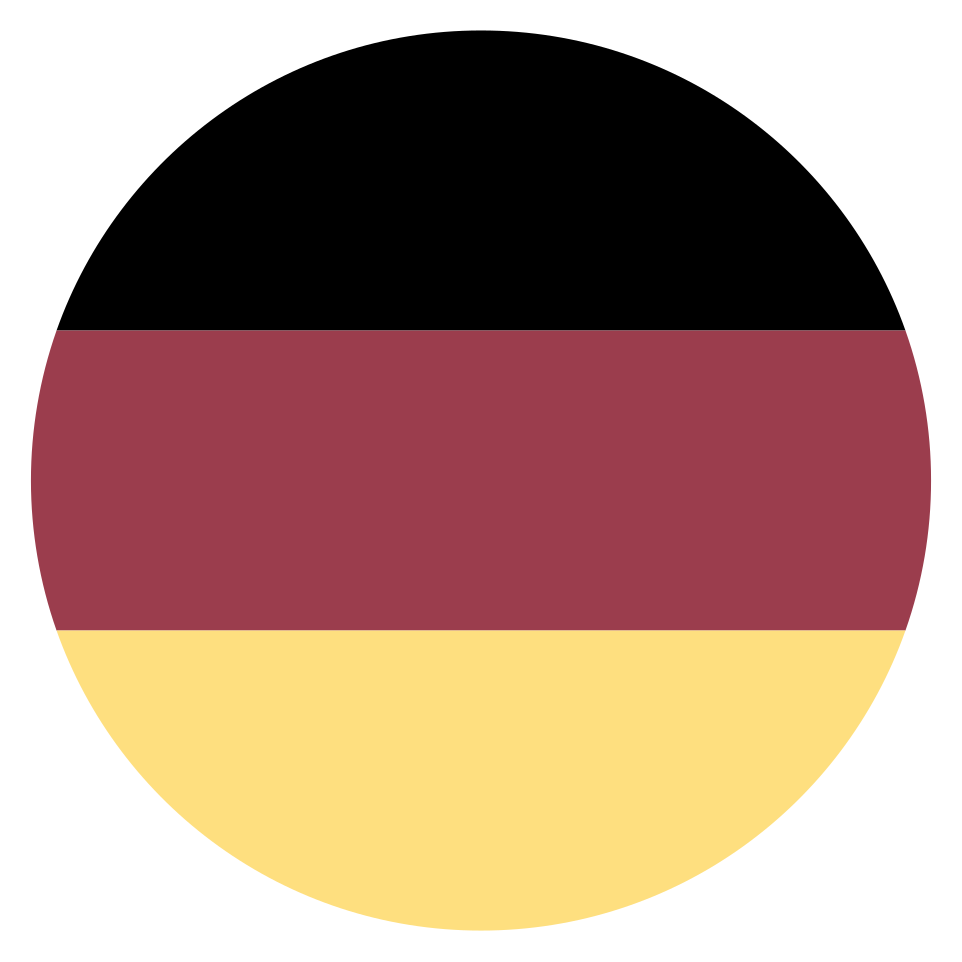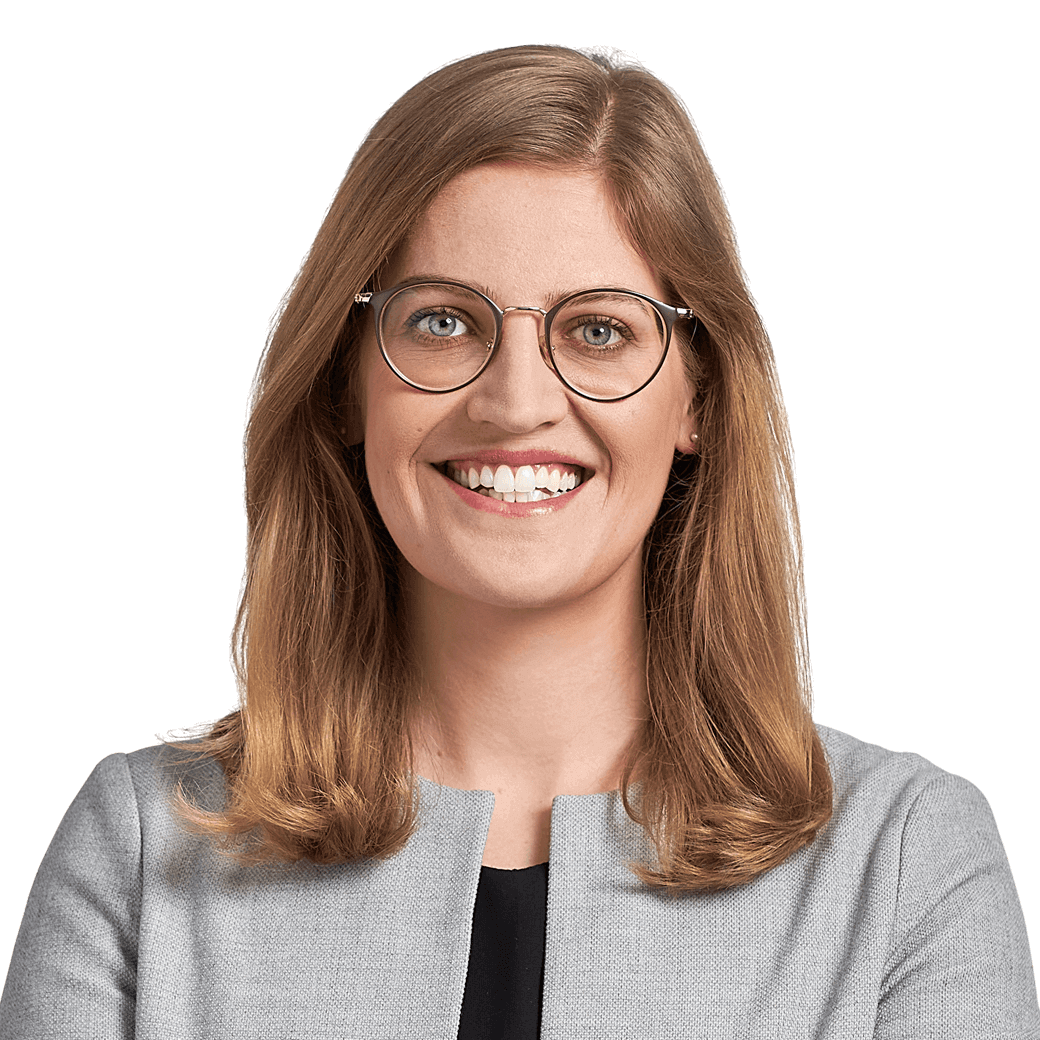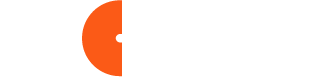Sustainable Aviation Fuel (SAF) – Europäische und deutsche Gesetzgebung
Veröffentlicht am 1st Juli 2025
Der Luftverkehr macht ca. 3,8 % der Treibhausgasemissionen der EU aus. Er gilt als einer der Sektoren, in denen Klimaneutralität am schwierigsten zu erreichen ist. Lokal klimaneutrale Flugzeuge (z.B. Wasserstoff- oder Elektroflugzeuge), die im Betrieb keine CO2-Emissionen erzeugen, sind noch weit von der Marktreife entfernt. Eine Alternative bietet Sustainable Aviation Fuel (SAF), das im Hinblick auf die Lebenszyklusemissionen klimafreundlich ist. Deutschland und die EU forcieren derzeit den Markthochlauf von SAF, sodass in den kommenden Jahren mit einem stetig wachsenden Markt zu rechnen ist. Daher ist es höchste Zeit, sich mit den regulatorischen Grundlagen für SAF vertraut zu machen.

1. Was ist SAF?
SAF ist eine Sammelbezeichnung für nachhaltige Flugkraftstoffe. Chemisch unterscheiden sie sich nicht wesentlich von fossilem Kerosin, weshalb sie ohne weiteres zur Betankung von herkömmlichen Flugzeugen verwendet werden können. SAF sind nicht lokal klimaneutral, d.h. sie emittieren bei der Verbrennung CO2. Jedoch können sie über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg bis zu 80 % an CO2-Emissionen gegenüber fossilem Kerosin einsparen. Das liegt daran, dass das emittierte CO2 vorher der Atmosphäre entzogen wurde. Es entsteht also ein CO2-Kreislauf. Es gibt unterschiedliche Arten von SAF. Art. 3 Nr. 7 Verordnung (EU) 2023/2405 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr (Initiative ReFuelEU Aviation) („ReFuelEU-VO“) unterscheidet zwischen synthetischen Flugkraftstoffen, Biokraftstoffen für die Luftfahrt und wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Flugkraftstoffen.
Synthetische Flugkraftstoffe oder E-Kerosin wird durch die Synthese von Wasserstoff und CO2 hergestellt. Damit E-Kerosin klimafreundlich ist, muss der Wasserstoff klimaneutral erzeugt werden, z.B. durch erneuerbare Energien (grüner Wasserstoff) oder Kernenergie (roter Wasserstoff). Zudem muss das beigemischte CO2 der Atmosphäre vorab entzogen werden, z.B. mittels Direct-Air-Capture. Das Herstellungsverfahren wird auch Power-to-Liquid (PtL) genannt.
Biokraftstoffe für die Luftfahrt oder Biokerosin wird aus Biomasse hergestellt. Hierfür kommen unter anderem landwirtschaftliche Abfälle, Ölsaaten oder Algen in Betracht. Biokerosin ist klimafreundlich, da bei der Verbrennung nur CO2 freigesetzt wird, das zuvor während des Wachstums der Pflanzen oder Tiere, von denen die Biomasse stammt, in der Biomasse gebunden wurde.
Wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe werden aus Abfällen nicht erneuerbaren Ursprungs hergestellt, z.B. Industrieabgasen. Sie sind nur klimafreundlich, wenn das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 ohne die Wiederverwertung als Flugkraftstoff unmittelbar freigesetzt worden wäre.
Die deutsche und EU-Gesetzgebung stellen zum Teil zusätzliche Anforderungen an die einzelnen SAF-Varianten, was unter 2.4 und 3.1 dargestellt wird.
2. Was gilt in der Europäischen Union?
Die EU möchte mit der ReFuelEU-VO den Markthochlauf von SAF vorantreiben, indem sie die Beimischung eines steigenden Mindestanteils von SAF zu konventionellem Kerosin vorschreibt.
2.1 Flugkraftstoffanbieter
Nach Art. 4 Abs. 1 ReFuelEU-VO sind Flugkraftstoffanbieter verpflichtet, Kerosin einen Mindestanteil SAF beizumischen. Ab dem Jahr 2025 beträgt der Mindestanteil 2 %, ab 2030 6 % und bis 2050 steigt er auf 70 %. Ab 2030 gilt zudem eine Unterquote für synthetisches Kerosin. Danach ist konventionellem Kerosin mindestens 0,7 % synthetisches Kerosin beizumischen. Bis 2050 steigt die Unterquote für synthetisches Kerosin auf 35 %.
2.2 Fluggesellschaften
Fluggesellschaften sind gem. Art. 5 Abs. 1 ReFuelEU-VO verpflichtet, mindestens 90 % ihres Jahresbedarfs an Kerosin für Flüge, die in der EU starten, an Flughäfen in der EU zu tanken. Eine Unterschreitung dieses Schwellenwertes ist nach Art. 5 Abs. 2 ReFuelEU-VO aus Gründen der Kraftstoffsicherheit zulässig. Dies dient zur Einhaltung bestimmter Pflichtreserven, um z.B. Ausweichflughäfen erreichen zu können.
Die Betankungspflicht soll verhindern, dass Fluggesellschaften zum Tanken auf Flughäfen außerhalb der EU ausweichen, um dort günstigeres Kerosin ohne beigemischtes SAF zu tanken.
2.3 Anforderungen an SAF
Synthetische Flugkraftstoffe werden in Art. 3 Nr. 12 ReFuelEU-VO nicht unmittelbar definiert. Stattdessen verweist die Norm auf die Definition der erneuerbaren Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs („RFNBO“) nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 36 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) („RED III“). RFNBO sind danach Kraftstoffe, deren Energiegehalt aus erneuerbaren Energiequellen mit Ausnahme von Biomasse stammt. In RED III finden sich zudem weitere Anforderungen. Für synthetische Flugkraftstoffe gelten aber nur Art. 29 Abs. 1 und 30 RED III, denn nur hierauf verweist Art. 3 Nr. 12 ReFuelEU-VO. Danach muss synthetischer Flugkraftstoff im Laufe seines Lebenszyklus zu einer Treibhausgasminderung von mindestens 70 % führen und entsprechend zertifiziert sein. Hingegen erfolgt kein Verweis auf Art. 27 Abs. 6 RED III. Damit gelten für synthetische Flugkraftstoffe auch nicht die Vorgaben für RFNBO nach der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1184 der Kommission zur Ergänzung der RED III durch die Festlegung einer Unionsmethode mit detaillierten Vorschriften für die Erzeugung flüssiger oder gasförmiger erneuerbarer Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs für den Verkehr, die auf Art. 27 Abs. 6 RED III basiert (mehr dazu unter 3.1).
Kein synthetischer Flugkraftstoff ist nach der Definition synthetischer Flugkraftstoff, für dessen Herstellung Wasserstoff durch Kernenergie erzeugt wurde (roter Wasserstoff). Jedoch kann dieser nach Art. 3 Nr. 13 ReFuelEU-VO als synthetischer kohlenstoffarmer Flugkraftstoff gelten, wenn er im Laufe seines Lebenszyklus zu einer Treibhausgasminderung von mindestens 70 % führt und entsprechend zertifiziert ist. Kohlenstoffarme Flugkraftstoffe (sowie erneuerbarer und kohlenstoffarmer Wasserstoff) können nach Art. 4 Abs. 2 ReFuelEU-VO anstelle von SAF verwendet werden.
Biokraftstoffe für die Luftfahrt werden in Art. 3 Nr. 8 ReFuelEU-VO auch mit Verweis auf RED III definiert. Danach wird unterschieden zwischen:
- Fortschriftlichen Biokraftstoffen, die aus den in Anhang IX Teil A RED III aufgeführten Rohstoffen (z.B. Algen, Gülle oder Nussschalen) hergestellt werden,
- Biokraftstoffen, die aus den in Anhang IX Teil B RED III aufgeführten Rohstoffen (z.B. gebrauchtes Speiseöl, tierische Fette oder Abwasser) hergestellt werden, und
- sonstigen Biokraftstoffen, die nicht aus Nahrungsmittel- und Futtermittelpflanzen hergestellt werden, die im Laufe ihres Lebenszyklus zu einer Treibhausgasminderung von mindestens 70 % führen.
Hintergrund des Ausschlusses von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen für die Herstellung von Biokraftstoff für die Luftfahrt ist nach Erwägungsgrund 23 ReFuelEU-VO, dass eine Flächenkonkurrenz und eine damit einhergehende erhöhte Landnutzung vermieden werden sollen.
Für wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe gilt nach Art. 3 Nr. 9 ReFuelEU-VO und Art. 2 Nr. 35 RED III ebenfalls, dass sie im Laufe ihres Lebenszyklus zu einer Treibhausgasminderung von mindestens 70 % führen und entsprechend zertifiziert sein müssen. Zusätzlich müssen sie aus flüssigem oder festem Abfall hergestellt werden, der für eine stoffliche Verwertung nach Art. 4 Richtlinie 2008/98/EG (EU-Abfallrichtlinie) nicht geeignet ist, oder aus Gas aus der Abfallverarbeitung oder Abgas, das zwangsläufig und unbeabsichtigt infolge der Produktionsprozesse in Industrieanlagen entstehen. Damit soll sichergestellt werden, dass bei der Verbrennung des Flugkraftstoffs tatsächlich nur CO2 freigesetzt wird, dass ohnehin freigesetzt worden wäre.
2.4 Verhältnis zum EHS und CORSIA
Bereits vor Inkrafttreten der SAF-Quote unterlag der innereuropäische Luftverkehr dem EU-Emissionshandelssystem („EHS“). Danach müssen Emittenten für jede Tonne emittiertes CO2 Zertifikate erwerben. Da die Gesamtmenge der Zertifikate jährlich sinkt, sinken somit auch jährlich die Gesamtemissionen der erfassten Sektoren. Nicht-innereuropäische Flüge unterliegen seit 2021 dem Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). CORSIA verpflichtet Fluggesellschaften zur Begrenzung der CO2-Emissionen auf das Niveau des Jahres 2019. Das Wachstum der Branche soll dadurch klimaneutral sein. Darüberhinausgehende Emissionen müssen kompensiert werden.
Art. 9 Abs. 1 ReFuelEU-VO bestimmt, dass Fluggesellschaften die Verwendung ein und derselben Charge SAF nicht im Rahmen mehrerer Treibhausgasminderungssysteme geltend machen können. Fluggesellschaften müssen sich demnach entscheiden, ob sie eine Charge SAF entweder auf ihre Verpflichtungen nach dem EHS oder nach CORSIA anwenden wollen. SAF haben im EHS und bei CORSIA einen Emissionsfaktor von null, d.h. sie gelten nicht als Verursacher von Treibhausgasemissionen. Zudem erhalten Fluggesellschaften nach Art. 3c Abs. 6 Richtlinie 2003/87/EG (EHS-Richtlinie) im Zeitraum von 2024 bis 2030 bis zu 20 Millionen kostenlose Emissionszertifikate für die Verwendung von SAF. Noch weiter gehen möchte die neue Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass die Hälfte der EHS-Einnahmen aus der Luftfahrt zur Förderung des Markthochlaufs von SAF verwendet werden sollen.
3. Was gilt zusätzlich in Deutschland?
In Deutschland gilt auch eine nationale Beimischungsquote für Kraftstoff aus erneuerbaren Energien nicht-biogenen Ursprungs für Kerosin. Nach § 37a Abs. 4a BImSchG gilt die Quote ab 2026 und beträgt 0,5 %, 1 % ab 2028 und 2 % ab 2030. Die Zukunft dieser nationalen Quote ist ungewiss. Im Koalitionsvertrag hat sich die schwarz-rote Koalition auf ihre Abschaffung verständigt. Ein am 19. Juni 2025 veröffentlichter Referentenentwurf eines zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote sieht vor, die nationale SAF-Quote durch eine allgemeine Quote für alle Verkehrsbereiche zu ersetzen.
3.1 Nationale Anforderungen an SAF
Die Anforderungen an den beigemischten Kraftstoff sind in der 37. BImSchV geregelt. Dabei übernimmt § 2 Abs. 3 37. BImSchV die EU-Definition von RFNBO nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 36 RED III. Dennoch gibt es Unterschiede zur EU-Definition von synthetischem Flugkraftstoff. Wie bei der EU-SAF-Quote muss nach § 10 Abs. 1 37. BImSchV mindestens eine Treibhausgasminderung von 70 % erreicht und dies auch entsprechend der EU-Methodik nachgewiesen werden. Hinzu kommen jedoch die Anforderungen nach den §§ 3 ff. 37. BImSchV. Diese entsprechen den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2023/1184, die für synthetische Flugkraftstoffe nach der EU-SAF-Quote gerade nicht gilt.
Der Strom für die Erzeugung von RFNBO muss grundsätzlich folgende Kriterien erfüllen:
- Zusätzliche Stromerzeugung, § 6 37. BImSchV: RFNBO sollen nur mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, der in Anlagen (Windparks, PV-Parks, etc.) erzeugt wurde, die zusätzlich zu bestehenden Anlagen errichtet worden sind.
- Zeitliche Korrelation, § 7 37. BImSchV: Der Strom aus erneuerbaren Energien soll in einem engen zeitlichen Rahmen mit seinem Verbrauch zur Herstellung von RFNBO erzeugt werden.
- Geografische Korrelation, § 8 37. BImSchV: Der Strom aus erneuerbaren Energien soll in derselben Stromgebotszone erzeugt werden, in der er zur RFNBO-Herstellung verbraucht wird.
In Deutschland gilt somit, anders als im Rest der EU, bereits vor 2030 eine Beimischungsquote für synthetische Flugkraftstoffe (und nicht nur für SAF im Allgemeinen), die 2030 deutlich über der EU-Quote von 0,7 % liegen wird und strengere Anforderungen an die Herstellung des Kraftstoffs stellt.
3.2 Verhältnis zur EU-SAF-Quote
Da es sich bei der EU-SAF-Quote ausweislich des Wortlauts der Verordnung um einen „Mindestanteil“ handelt, ist der nationale Gesetzgeber berechtigt, darüberhinausgehende Anforderungen zu festzulegen. Konkret bedeutet das, dass die nationale Quote insoweit greift, wie sie nicht bereits durch Erfüllung der EU-SAF-Quote geboten ist. Für synthetischen Flugkraftstoff gelten zudem in Höhe der nationalen Quote die strengeren Anforderungen nach der 37. BImSchV.
4. Fazit und Ausblick
Die EU-SAF-Quote ist grundsätzlich positiv zu sehen, da sie einen Anreiz für einen Markthochlauf von SAF schaffen kann. Da alternative, klimaneutrale Antriebssysteme für Flugzeuge absehbar nicht zur Verfügung stehen, ist auch nicht zu befürchten, dass es zu einer Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Technologien kommt. Zudem wurde ein gutes Zusammenspiel mit dem Emissionshandel gefunden. Die SAF-Quote stellt nämlich keine zusätzliche Verpflichtung zur Emissionsreduktion dar, sondern weist einen Weg zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Emissionsreduktion.
Fraglich ist hingegen, ob die vorgeschriebenen Quoten auch zu einem Markthochlauf in dem gewünschten Umfang führen werden, sodass die Preise tatsächlich sinken. Hierzu wäre denkbar, die hinter SAF steckende Technologie (E-Fuels) auch für andere Branchen als die Flugbranche zu öffnen, beispielsweise für die Automobilindustrie, was politisch umstritten ist. Schließlich wirft die neue Koalition mit Recht die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen deutschen SAF-Quote auf. Eine allgemeine Quote für alle Verkehrsbereiche könnte hier Abhilfe schaffen und zugleich auch den Markthochlauf der Technologien, auf denen SAF basieren, in anderen Sektoren fördern.
Den Artikel können Sie hier als PDF herunterladen.