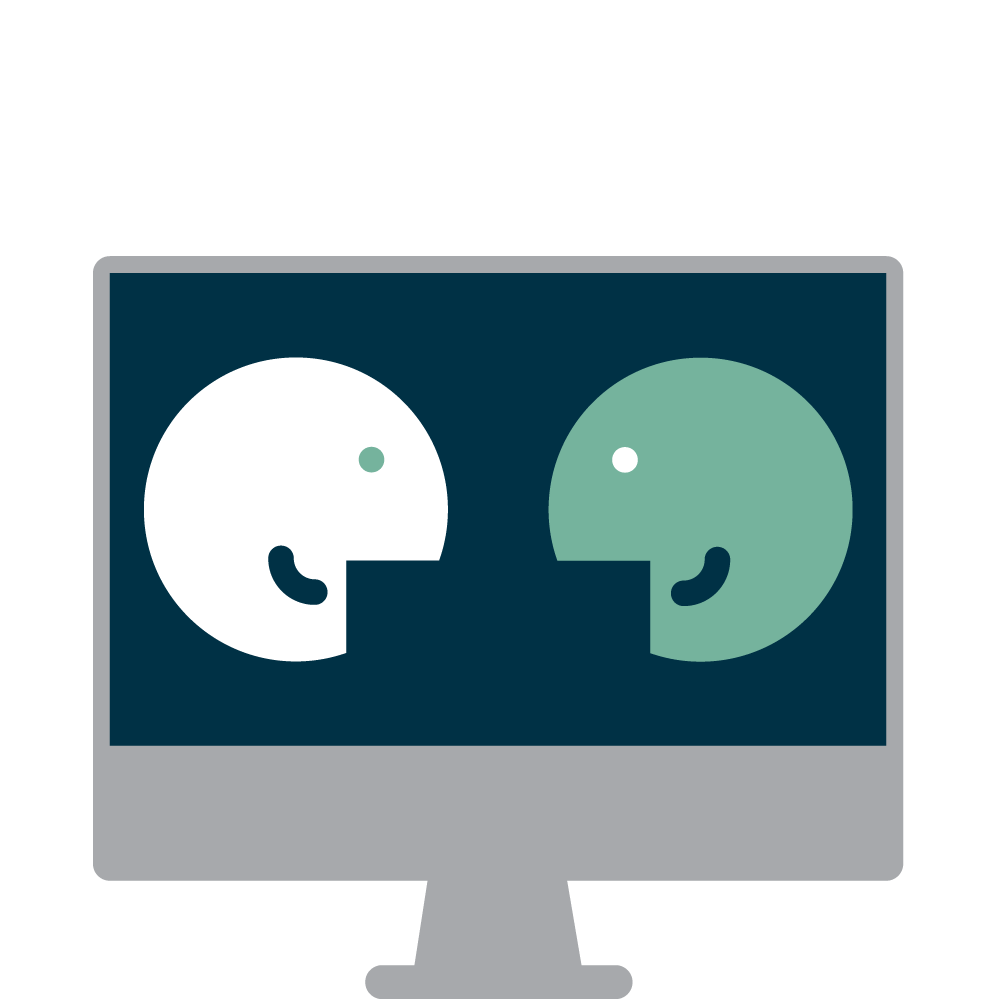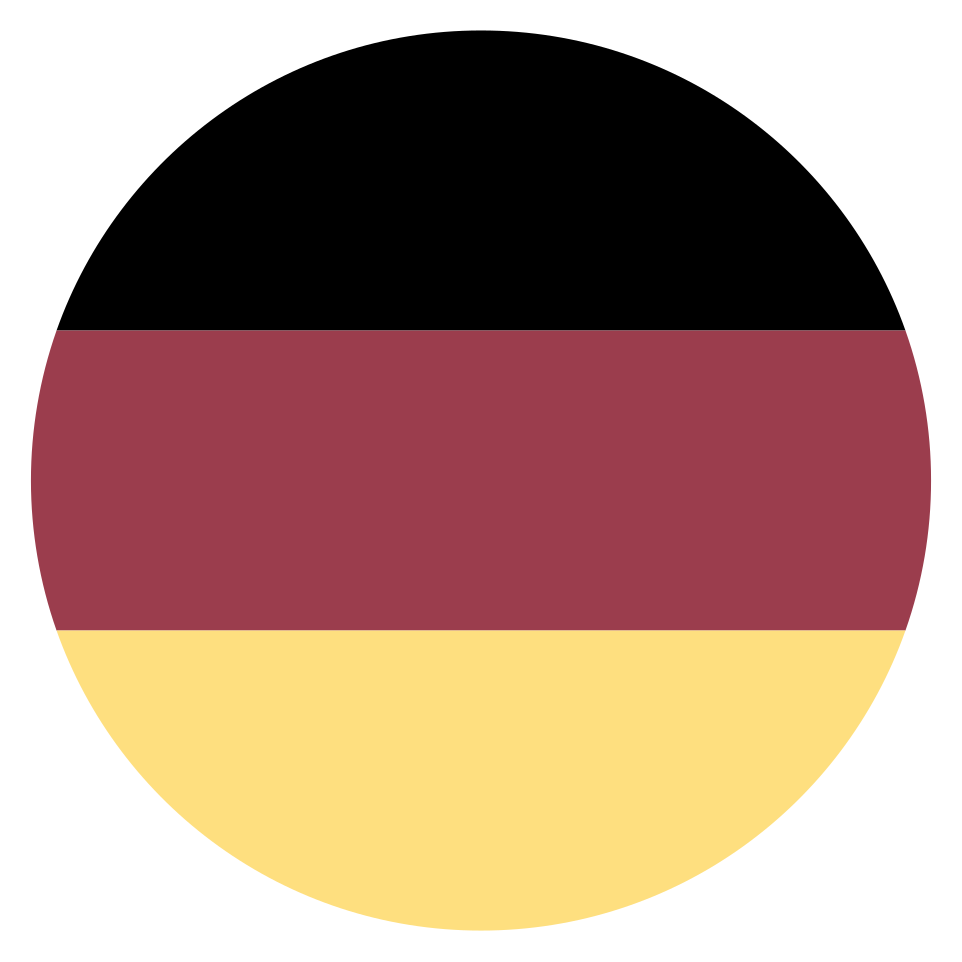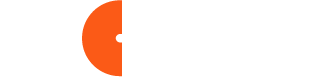BGH zur Berücksichtigung von streitig titulierten Forderungen bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit
Veröffentlicht am 22nd April 2025
BGH Urt. v. 23.1.2025 - IX ZR 229/22

Um das Unternehmen vor der Insolvenz zu schützen, sind zwei Zustände zu vermeiden: die Überschuldung und die Zahlungsunfähigkeit. Wenn auch das eine das andere nicht ausschließt, ist die Zahlungsunfähigkeit der Insolvenzgrund, der nicht nur häufiger, sondern auch sehr viel plötzlicher auftritt. Nach § 17 InsO ist man zahlungsunfähig, wenn man „nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen.“ Zu dieser Definition hat die Rechtsprechung über Jahrzehnte hinweg Ergänzungen, Ausnahmen und Erläuterungen beigetragen, in die sich auch das hier behandelte Urteil einreiht. Ungeachtet der Vielfalt der Details werden zur Prüfung der Zahlungsfähigkeit jedoch immer die liquiden Mittel den fälligen Verbindlichkeiten gegenübergestellt. Das Urteil des BGH vom 23. Januar 2025 erläutert, inwiefern auch streitig titulierte Forderungen bei der Prüfung als „fällige Verbindlichkeiten“ in die Prüfung einzufließen haben. Streitig titulierte Forderungen sind hierbei Forderungen, die durch einen vorläufig vollstreckbaren Titel rechtlich anerkannt wurden, zugleich aber weiterhin vom Schuldner bestritten werden.
Der BGH entschied, dass, sobald die Vollstreckung begonnen hat, der Nennwert eines vorläufig vollstreckbaren Titels bei der Prüfung der Zahlungsunfähigkeit auch dann als fällige Verbindlichkeit zu berücksichtigen ist, wenn sie streitig ist.
Entscheidung
Der Kläger des – hier vereinfacht wiedergegebenen – Rechtsstreits war der Insolvenzverwalter der Insolvenzschuldnerin. Beklagte war eine Rechtsanwaltskanzlei. Die Schuldnerin vergütete die Kanzlei. Der Kläger verlangte die Zahlungen zurück und stützte sich auf eine Vorsatzanfechtung. Hiernach sind Zahlungen der Insolvenzschuldnerin an diese zurückzugewähren, wenn – unter anderem – die Schuldnerin bei der Zahlung den Vorsatz hatte, ihre Gläubiger zu benachteiligen. Dies ist dann gegeben, wenn sie zum Zeitpunkt erkanntermaßen zahlungsunfähig war. Dies war streitig.
Zuvor wurde die Schuldnerin von der B KG im Urkundenverfahren auf Darlehensrückzahlung verklagt. Streitig war bei der Darlehensforderung die Fälligkeit. Vertreten wurde die Schuldnerin von der nun beklagten Kanzlei. Das Urkundenverfahren endete zum Nachteil der Schuldnerin mit einem vorläufig vollstreckbaren Urkundenvorbehaltsurteil auf Zahlung in Höhe von EUR 2,3 Mio. Die B KG betrieb hieraus die Zwangsvollstreckung.
Die Zahlungen der Schuldnerin an die Kanzlei, welche nach Beginn der Zwangsvollstreckung stattfanden, wurden angefochten. Das LG bejahte, das OLG verneinte das Anfechtungsrecht.
Rechtlich streitig unter den Gerichten war die Wirkung eines vorläufig vollstreckbaren Titels auf die Berücksichtigung streitiger Forderungen bei der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit. Dies wurde seit jeher stark diskutiert:
Nach einer Ansicht ist nur die materielle Rechtslage, nicht aber die formelle Möglichkeit einer Vollstreckung von Bedeutung.
Nach anderer Ansicht ist die vorläufig vollstreckbar titulierte Forderung in voller Höhe zu berücksichtigen.
Nach dritter Ansicht ist bei solchen titulierten streitigen Forderungen stets nur ein Anteil des Nennwerts anzusetzen.
Der BGH entschied: Zahlungsunfähigkeit ist ein objektiver Zustand. Es kommt auf die objektive Rechtslage an. Ein objektiv unbegründeter vorläufiger Titel begründet nicht von sich aus Zahlungsunfähigkeit.
Aber: Der vorläufige Titel wirkt sich auf Beweisebene aus. Er kann den Nachweis liefern, dass die objektive Rechtslage so ist, wie sie der Titel beschreibt. Einwendungen des Schuldners gegen die titulierte Forderung oder Vollstreckbarkeit sind, solange der Titel vollsteckbar ist, nicht zu berücksichtigen. Diese Einwendungen müssten in den dafür vorgesehenen Verfahren geprüft werden.
Hinzu kommt: Da der Titelgläubiger die titulierte Forderung selbst für zweifelhaft halten könnte, ist der Nennwert erst bei Einleitung der Vollstreckung bei der Zahlungsunfähigkeit zu berücksichtigen. Denn dieses Verhalten steht solchen Zweifeln entgegen.
Folge und Ausblick
Die Frage der Zahlungsunfähigkeit stellt sich in etlichen insolvenzrechtlichen Prüfungen. Aufgrund der einheitlichen Begriffsdefinition wirkt sich das Urteil also nicht nur auf die Prüfung diverser Anfechtungstatbestände, sondern beispielsweise auch auf die Geschäftsleiterhaftung und -strafbarkeit nach §§ 15a bzw. 15b InsO und die Eröffnungsfähigkeit des Insolvenzverfahrens aus.
Für die Praxis ergibt sich damit selbst bei Streitigkeit eine enorme Schlagkraft vorläufig vollstreckbarer Forderungen. Das sind – sogar ohne Sicherheitsleistung – etwa Forderungen aus Versäumnisurteilen, Urteilen im Urkunden-, Wechsel oder Scheckprozess und Anerkenntnisurteilen. Je nachdem, ob eine Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt oder vermieden werden soll, ist es ratsam, derartige Titel zu verfolgen oder zu verhindern. Soll die Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt werden, sollte neben dem Titel auch frühzeitig die Vollstreckung begonnen werden.
Die Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit kann unter Umständen – so paradox es zunächst klingen mag – gerade für Gläubiger von Interesse sein. Sie sind befugt, einen Insolvenzantrag zu stellen und damit ein Insolvenzverfahren in die Wege zu leiten, welches wiederum die Zahlungsunfähigkeit (oder die Überschuldung) voraussetzt. Damit können sie darauf hinwirken, dass sich die finanzielle Lage des Schuldners nicht weiter durch Misswirtschaft verschlechtert und dass die vorhandenen Vermögenswerte fair unter den Gläubigern verteilt werden.